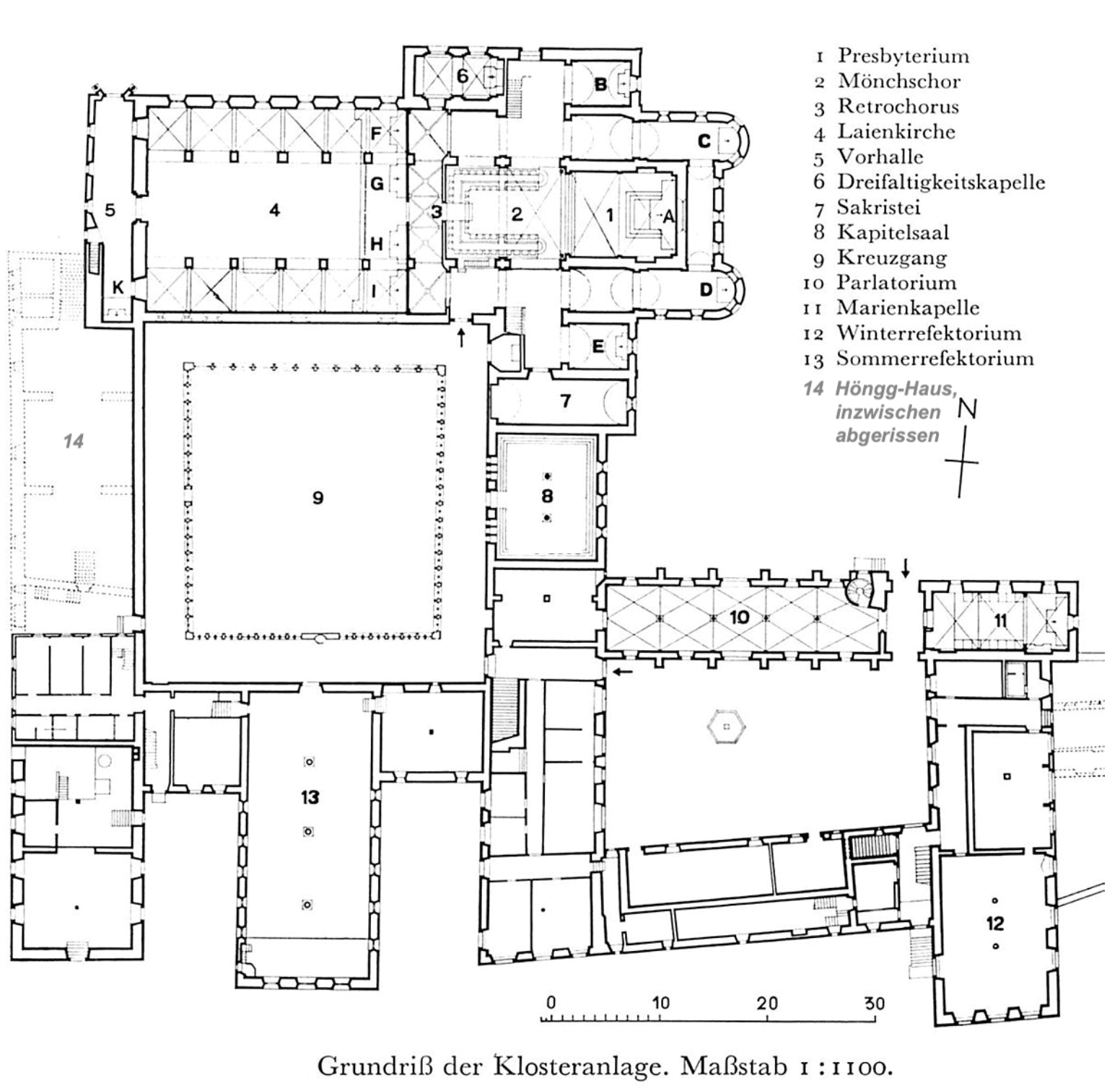Im Februar 2021 gelangte die Familie Monika und Markus Bitterli-Güntert mit der Frage an mich, ob ich an den handschriftlichen Aufzeichnungen ihres Urgrossvaters Emilian Güntert interessiert sei.
Eine erste Sichtung ergab, dass von den 208 Seiten rund die Hälfte seiner Schilderungen (Seiten 1 bis 98) an seine ersten zwanzig Lebensjahre mit seinem Aufwachsen in der Heimatgemeinde Mumpf und seiner auswärtigen Ausbildung erinnern.
Der Rest der Einträge (Seiten 99 bis 208) betreffen seine andern Lebensstationen in Olsberg, Rümikon und Möhlin-Riburg, Familienereignisse, gesundheitliche Herausforderungen, finanzielle Nöte, sowie politische und gesellschaftliche Geschehnisse während seines Ruhestandes.
Emilian zeigt sich in den Aufzeichnungen als sehr sensibler Mensch. Nach dem Tod seiner Gattin muss er viele Kräfte frei machen, um das Leben weiter meistern zu können. Besonders berührt hat mich, wie sich das Nachlassen seiner Kräfte im Schriftbild auf den letzten Seiten zeigt.
Dank Emilian Güntert sind wir in der Lage, am täglichen Leben in der Zeit zwischen 1854 und 1875 hautnah dabei zu sein.
Kurzfassung zum Leben des Emilian Güntert
- Geboren am 7. Dezember 1854 als Sohn des Lehrers und Organisten Daniel Güntert.
- Primarschule in Mumpf (5 Jahre)
- Bürgerschule in Säckingen bis September 1870
- Von Oktober 1870 bis anfangs 1872 Ausbildung zum Anstaltslehrer in der Anstalt Bächtelen in Wabern, Kt. Bern. Diese Ausbildung wurde 1872 nach einem Vorfall aufgehoben.
- 1872 bis 1875: Ausbildung zum Lehrer am Lehrerseminar Wettingen
- 19. Mai 1875: Eintritt in den Dienst des Erziehungsheimes in Olsberg als Lehrer. Allerdings fühlt er sich hier nicht glücklich, weil die Erziehungsmethoden der Anstalt nur von Peitsche und Abschreckung geprägt sind anstatt einer liebevollen Zuwendung.
- 1875 wird er in den Militärdienst einberufen.
- Am 11. Januar 1877 kann er seine neue Stelle an der Schule Rümikon bei Zurzach antreten.
- Im Frühling 1883 übernimmt er an der Schule Möhlin-Riburg eine Schulabteilung. Er wohnt wieder in Mumpf bei seinen Eltern, denen er eine wichtige Stütze ist.
- 14. April 1884: Heirat mit Elise Wunderlin aus Wallbach, Tochter des dortigen Lehrers. Wohnsitz in Möhlin-Riburg.
- 16. März 1885: Geburt des Sohnes Alfred
- 2. Mai 1886: Geburt der Tochter Elisa
- 29. Jänner 1890: Tod seines Vaters
- 30. März 1926: Letzter Schultag in Riburg nach 51 Jahren aargauischem Schuldienst.
- 7. März 1927: Seine Frau Elise stirbt im Spital Rheinfelden.
- 1934 feiert er seinen 80. Geburtstag.
- 24. September 1940 Todestag
Aufnahme Carl Sevecke, Rheinfelden, um 1910
Ahnenfolge
Christoph Güntert und Elisabeth Schmid
Bernhard Güntert und Walburga Kienzlin
Cajus Güntert, 14. Februar 1820 - …
Daniel Güntert, 24.11.1821 – 29.1.1890
Martin Güntert, 12. März 1824 - …
Daniel Güntert, 1821 – 1890 und Sophie Baumgartner, 1826 – 1910
Edwin Oskar Güntert, 1. Juni 1850 – ...
Philemon Traugott Güntert, 25. Januar 1852 – ...
Emilian Güntert 7. Dezember 1854 – 24. September 1940
Blanka Güntert, 31. Mai 1858 – ...
Orpha Güntert, 30. August 1861 – ...
Josefa Güntert, 26. März 1863 – ...
Emilian Güntert, 7.12.1854 – 24.9.1940 und Elisa Wunderlin
Alfred Güntert, 16. März 1885 – 1944
Elise Güntert, 2.5.1886 – ...
Alfred Güntert, 1885 – 1944 und Martha Büechli 1887 - 1987
Dorli Güntert 1912 - 2003
Hans Güntert, 1918 – 1999
Helene Güntert 1928 - 2016
Hans Güntert, 1918 – 1999 und Ruth von-Euw 1926 - 2020
Peter Güntert, 1946
Monika Bitterli-Güntert, 1951
Ich wurde geboren den 7. Dezember 1854 im schönen Dörfchen Mumpf am Rhein. Mein seliger Vater hiess Daniel Güntert, die Mutter Sophie Baumgartner. Sie war der letzte Sprosse Baumgartner in Mumpf, mit ihr losch dieses Geschlecht aus. Der Vater hatte noch vier Brüder, diese überlebten ihn bis auf einen. Die Mutter hatte nur einen Bruder, der später
auf den Lohnberg bei Zutzgen zog, wo er sich ein kleines Hofgut erwarb. Dorthin zog er dann mit Frau und Kindern. Ich hatte noch zwei Brüder, der älteste hiess Oskar, der zweitälteste Philemon Traugott, dann hatte ich noch drei Schwestern, die jünger waren als ich. Die älteste hiess Blanka, die zweitälteste Josefine. Die jüngste hiess Orpha, der Bruder Oskar ist im
68. Lebensjahr an einem Schlaganfall gestorben, Philemon starb schon vor dem 30. Jahre an einer Kurzkrankheit, die jüngste Schwester starb schon im ersten Lebensjahr. Es leben also von unserer Familie gegenwärtig nur noch die zwei Schwestern zu mir, welche beide Witwen mit Kindern sind.
Nordwärts vom Dorfe fliesst der wunderschöne Rhein hin, der eben das Dörfchen auch noch aufschönen hilft, dann rezitiere ich gar oft jetzt noch in Gedanken jenes alte schöne Gedicht:
Ich lieb das schöne Örtchen,
wo ich geboren bin.
Hier blühte mein junges Leben
von Lieben rings umgeben
in immer heitrem Sinn. ...
O guter Vater droben
beschütz den Heimatort
und segne ihn mit Frieden,
viel Gutes sei beschieden
der Heimat fort und fort. ...
Mitten im Dorfe, nördlich der Strasse steht die alte Kirche mit Kürbissenturm, darauf turnen jeden Sommer die Zunft der Langbeiner. Sagten doch dazumal, als ich noch ein kleiner Knirps war, einige Offiziere, die den Berg hinunter gegen das Dorf zogen neben ihren Pferden: Man merkt es, dass man nun im Fricktal ist, dort oben zeigen sich ihre Störche.
Mitten im ehemaligen Gottesacker steht die Kirche. Schon seit vielen Jahren ist aber der Friedhof westlich vom Dorfe angelegt. An der alten Friedhofmauer gegen den Rhein hin ist ziemlich hoch oben eine Tafel angebracht, worauf die Rheinhöhe vom Jahr 1852 angegeben ist, welcher Wasserstand seither nie mehr erreicht wurde. Mitten im Rheine, etwa dem
jetzigen Pfarrhaus gegenüber, ragt ein Fels oder Stein fest aus dem Wasser bei tiefem Wasserstand. In diesem Fall wird dann jeweils von Mumpfer
Schiffern ein Tännchen mit flatternden Bändern befestigt, dies ist vom Ufer aus prächtig anzuschauen.
Das Dörfchen war früher meistens von Schiffern und Flössern bewohnt. Fast jeder Hausbesitzer besass auch einen Waidling, kleines Ruderschiff, alle waren am Ufer des Rheines mit Ketten angebunden. Jung wie Alt stand gern am Rheine und schaute dem Wassern zu. Wir Leute waren mehr am Rheine und im Sommer im Rhein als bei unsern nützlichen Arbeiten. Oberhalb des Dorfes hatte der Rhein eine Art Kanal, dort badeten wir fleissig. Es ist aber dort auch eine sichere Stelle zum Baden, denn soweit ich mich zurück erinnere, ist im Rheine von jungen Leuten weder Knabe noch Mädchen ertrunken.
Ein Floss bestand aus lauter Tannenstämmen. Die untere Schicht Stamm an Stamm, abwechselnd das dickere und das dünnere Ende neben einander gelegt. Vorn und hinten quer darüber wurde ein Stänglein in die Stämme mit Eisenhaken befestigt, damit die Stämme nicht auseinander rutschen konnten. Mitten über den Floss wurde noch ein dickes Flossseil, ein 3-4 cm dickes Hanfseil geschlungen zur Befestigung. Hinten hatte der Floss zwei Ruder, vorne eines. Das Ruder bestand aus einer etwa 5 m langen Stange, hinten daran war ein 2 m langes, 4 dm breites Brett angenagelt. Die Stange lag zwischen zwei starken Holzstäben, die in einem Stamme senkrecht befestigt waren und verbunden mit Weiden. Das Ende der Stange hatte zwei Griffe, der eine senkrecht eingeschlagen, der andere waagrecht. Der Flösser am vordern Ruder hatte das Floss mehr zu steuern, die hintern zwei hatten dasselbe zu treiben. Bei ganz tiefem Wasserstand waren aber vorn auch zwei Ruder, im ganzen somit vier. Derjenige Flösser, der nun die sogenannten „Kehre“ hatte, musste seine zwei Mitfahrer bestimmen. Einer ging mit ihm nach Sisseln, Säckingen oder Murg, wo der Floss gemacht
wurde, und denselben zu holen, natürlich zu Fuss dorthin in aller Frühe. Der dritte Mann hatte in Mumpf, wenn Flösser aus Mumpf die Regie hatten, am Ufer Ausschau zu halten und sobald der Ruf vom Flosse aus erschallt: „Dritte Ma ufe“, so wurde dieser dritte Mann in seinem Waidling zu dem Flosse geführt. Jeder Flösser hatte ein Handbeil, einer auch einen grösseren Bohrer, und ein dünneres Seil nachzutragen.
Ich durfte zweimal als kleiner Bube eine Flossfahrt von Mumpf nach Basel machen. Es war dies aber nur, wenn Vater die „Regie“ hatte. Eine schöne
interessante Fahrt ist eine Flossfahrt, besonders bei mittlerem Wasserstand. Unterhalb Wallbach war das kleine „Gewild“, wo die Wellen zwischen den Stämmen des Flosses herauf spritzten. Bei Beuggen im Badischen begann das grosse „Gwild“. Bei der Kirche vorbei zog jeder Flösser seinen Hut oder sein Käpplein herunter, faltete die Hände und sprach ein stilles Gebet, denn jetzt galt es, das Fahrzeug sicher zwischen Felsen und Steinen hindurch zu leiten, damit der Floss nicht zerrissen oder an einem Pfeiler der Rheinbrücke zerschellt wurde. Mir wurde zugerufen: „Büebli sitz uf die oberste Tanne und zieh Bei a“, denn jetzt spritzten die Wellen mannshoch zwischen den Tannenstämmen herauf, so dass man doch etwas vernässt wurde. Von Rheinfelden an war eine recht schöne ruhige Fahrt bis Basel. Oft musste ein Floss in Kaiseraugst schon landen und dort warten, bis in Basel wieder Platz frei war. Das dünkte mich bei einer solchen Flossfahrt gar schön, wenn die beiden Flussufer rheinaufwärts sprangen und ich so stillstehend mich auf dem Floss befand. In Basel kamen oben an der alten Rheinbrücke, es war ja dazumal nur eine Brücke über den Rhein, zwei Schiffer von Basel entgegen. Unterhalb der jetzigen Kaserne wurde der Floss gelandet. Ein grosses Seil wurde vom Ufer aus auf den Floss geworfen. Dasselbe wurde um Stämme geschlungen. Vom Floss aus wurde auch ein Seil an das Ufer geworfen und dieses um eingerammte Pflöcke geschlungen und der Floss so nach und nach zum Hafen gebracht. Hier stiegen wir alle aus. Es ging zur Wirtschaft des Herrn Glaser, der dann auszahlte. Der die Regie hatte, bekam meines Erinnerns Fr. 15.-, jeder andere Flösser 11 Fr. Von Basel fuhr man mit der Badischen Bahn bis Rheinfelden. Dort wurde noch eingekehrt im „Salmen“, wo man noch eine hölzerne Wendeltreppe empor steigen musste und in eine altertümliche Stube trat. Von Rheinfelden ging es zu Fuss nach Hause, denn die Bötzberglinie war noch nicht eröffnet.
Winters vorgenommen.
Ich war auch dabei, als die Pfarrkirche die dritte Glocke erhielt. Wir Schulbuben durften diese Glocke vom Wagen aus auf den Turm ziehen mittelst eines Seiles. Alt und Jung erfreuten sich an diesem Akt. Die älteren Herren standen in Frack und Zilinder da. Denn ich erinnere mich noch gut, dass in den 60ger Jahren besser situierte Männer an Sonn- und Feiertagen immer im schwarzen langen Rock und Zilinder kamen. Mein Vater trug das nie. Alle Männer trugen dazumal noch Hemden mit Kragen aus einem Stück. Um den Kragen wurde gewöhnlich, besonders an Sonn- und Feiertagen, ein schwarzes seidenes Tüchlein geschlungen. Mein Vater erhielt jeden Neujahrstag von einer reichen Familie Tschudy ein solches Halstuch zum Geschenk.
In meinem 6. Lebensjahr erlebte ich den ersten Schrecken. Das Gasthaus zum „Bad“ brannte mitten in der Nacht. Natürlich holte mich meine Mutter aus dem Bett und zog mir das Höslein an und trug mich zur Brandstätte. Mein Vater streifte über den einen Ärmel ein weisses Armband mit rotem Kreuz. Es muss also dazumal schon eine Art Samariterverein bestanden haben. Ich habe dieses Armband öfters noch in seinem Schreibpult gesehen. Auch nahm er bei jedem Brandfall einen Sack mit. Es wurde eigentümlich „geflökt“ bei diesem Brand. Viele Sachen wurden kurzerhand zu den Fenstern hinausgeworfen, sogar Spiegel und Bildertafeln. Das Badhaus stand auf nämlicher Stelle, wo jetzt das Gasthaus zum Anker steht. Diesem gegenüber am Rheinbord stand das Badehäuschen, wo an Sonntagen gebadet und geschröpft wurde. Es wurde das Badhaus meistens von Frauen besucht, behufs Heilung rheumatischer Leiden. Ihre Männer warteten unterdessen geduldig oben im Wirtshaus, bis ihr Gespans zurückkehrte und beide dann noch ein Schöpplein nahmen. Als man nun das Fundament zum jetzigen Gasthaus aushob, stiess man auf dicke und viele Mauern, eine Wasserleitung zum Teil unter die Nachbarhäuser. Das Ausgraben wurde lange fortgesetzt und blossgelegt viele Mauern und Strassenteile. Viel Volk bewunderte dieses Mauerwerk, wurde aber bald wieder eingedeckt. Denn man kannte damals noch keine Altertumsforscher und Heimatschützler.
Mein Geburtshaus war das nächste Haus oberhalb des Gasthauses zur „Glocke“, unterhalb der Dorfstrasse, unmittelbar am Bache. Hinterhalb der Wohnung war ein Schopf, in dem und auf dem wir Scheiter und Wellen aufgeschichtet hatten. Einmal schickte mich die Mutter auf das „Läubeli“, ihr einen Korb voll Holz zu holen. Ich ging flugs mit demselben, denn ich war gewohnt den Eltern schnell zu folgen, darum war ich auch stets, in Wahrheit, der lieben Mutter Liebling geworden. Wie ich so meinen Korb mit Holz füllte, hörte ich Buben dem Bach entlang gegen den Rhein hinunter springen. Ich rief denselben noch, hing dabei zu weit über die Scheiterbeige hinaus und stürzte etwa 4 m tief in den Bach hinunter, aber mit dem gefüllten Korb voran, so dass mich dieser vor zu schwerem Fall schützte. Kinder haben ihren Schutzengel, heisst es.
Der Bruder meiner Mutter wohnte in den 60ger Jahren auf dem Lohnberg, wo ein Weiler jetzt noch ist. Dort hatte er sich ein kleines Hofgut erworben, das liegt wohl eine Stunde von Mumpf entfernt. Wir drei Brüder wanderten oft hinauf um etwas dort zu holen oder hinzutragen. Wir machten uns aber fast jedesmal erst Nachts auf den Heimweg, denn es dünkte uns gar lustig, so bei dunkler Nacht durch den finstern Wald hinunter zu springen. Wir führten uns aber sorglich, damit keiner von uns zu Fall kam oder gar verloren ging. Bei dem Hofe des Vetters war auch ein sogenannter Sodbrunnen, wie es jetzt noch solche hat, denn Quellen gibt es dort nicht. Quell- oder Trinkwasser holen sich jetzt noch die Höfler am untern Abhang des Lohnberges gegen Zuzgen hin. Ein Sodbrunnen besteht aus einem bis 10 oder mehr Meter tiefen kreisrunden Loch. Oben steht eingerammt auf zwei Randseiten ein Pfosten, darüber liegt eine kleine Walze, darum eine Kette gewunden. Am Ende der Kette ist ein schweres Gefäss befestigt, das unten ein Eisenbeschläge hat. An dieser Kette wird der Kübel in den Sodbrunnen hinunter gelassen, wo er mit dem dort gesammelten Regenwasser gefüllt wird. Dann wird das Gefäss mittelst der Walze, die an jedem Ende einen Hebelarm hat, herauf gewunden.
Der Vetter, der ein etwas unruhiger Bürger war und nicht sehr gern schaffte, wanderte dann, da ich etwa 6 Jahre zählte, nach Amerika aus. Auf einen Tag oder vielmehr Nacht wanderten sechs Familien von Mumpf nach Amerika aus. Diese mussten mit wenig Fahrhabe und Lebensmitteln am Morgen schon von Basel aus weiter fahren. Die Auswanderer mussten darum in der Nacht vorher schon per Fuhrwerk nach Basel gebracht werden. Ich erinnere mich noch ganz gut jener Nacht. Alle Häuser waren beleuchtet, Strassenbeleuchtung gab es noch nicht. Die Emigranten wurden auf Leiterwagen mit ihren Habseligkeiten geladen. Da gab es ein Abschiednehmen, Weinen, Jammern. Die Leute brachten noch dies und jenes, bis die Fuhrwerke abziehen mussten. Eine Eisenbahn gab es damals bei uns noch nicht. Die Auswanderer brauchten dazumal auch noch volle 6 Wochen, bis sie im neuen Weltteil landen konnten. Ebenso brauchte ein Brief von oder nach dort viele Wochen. Der Brief kostete 50 Rappen.
Eine weitere Erinnerung aus meiner frühesten Jugend ist Weihnachten. In Mumpf hatte bloss die Familie Waldmeyer zur „Sonne“ sich diesen „Luxus“ gestattet. Kinder erhielten ja jenesmal an Weihnachten wenig oder gar keine Geschenke. Eines Abends sagte die Mutter zu uns drei Buben: Heute Nacht kommt das Christkind und bringt Euch etwas, wenn ihr brav seid. Wir sassen alle drei neben einander auf die Kunst nur im Hemdlein. Die Vorhänge waren noch nicht gezogen, wir wohnten nämlich im ersten Stock, nicht Erdgeschoss. Da auf einmal fuhr etwas Weisses an dem Fenstern vorbei. Wir drückten schnell die Augen zu und getrauten uns nicht mehr aufzublicken. Da kam die Mutter herein und sagte: Das Christkind ist vorbei, was hat es Euch wohl gebracht? Sie öffnete das Fenster und brachte drei Tellerchen, auf denen „Chrömli“ aller Art lagen, auch „Fürstei“ dabei, solche hatte die Hausiererin im Erdgeschoss unseres Hauses feil. Noch viele Jahre bestand unser Weihnachtsgeschenk nur in einem Tellerchen voll Guetzeli bestehend in Backwerk von unserer Mutter. Ein Weihnachtsbäumchen sah ich erst viele Jahre später auf unserm Stubentisch, als meine zwei Schwesterchen etwas nachgewachsen waren. Aber Spielsachen oder gar Kleidungsstücke für eines der Kinder gab es nie, denn bei uns hiess es gar oft: Kein Geld mehr! Sei es manchmal auch für nötige Lebensmittel oder gar Kleider. Denn der Vater hatte ja, wie wir noch klein waren, eine Jahresbesoldung von 1000 Fr. Die Mutter musste manches kaufen aus dem Erlös von Butter oder Milch. Für ein Pfund Butter zahlte man damals 80 Rp. bis 1 Fr. und 1 Fr. 25 Rp. Ein Mass Milch (1 ½ l) galt 15 Rp. Dagegen war das Brot immer teuer, 1 Laib bis 1 Fr. Von Pate oder Patin erhielt man das Jahresgeschenk erst am Neujahrstag, ebenfalls kleine Gabe, etwa einem Wecken mit 1 Fr. erhielt ich von der „Gotte“, vom „Götti“ ein Paar Hosenträger. So fielen die Geschenke von dazumal gering aus, doch war man zufrieden damit.
Wir hatten einen älteren Mann als Siegrist. Der machte fleissig so kleine Kaubewegungen mit den Lippen. Wir sagten dann zueinander, wenn wir ihn so „müffeln“ sahen, er kaue wieder „Kerzenstümpen“, die er vom Altar weggenommen. Jeden Sonntagabend war eine Gebetsstunde in der Kirche, „Rosenkranz“ geheissen. Wir Kinder durften diesen nie versäumen. Der Siegrist leitete ihn und kniete zuvorderst in der ersten Bank. Er legte aber jedesmal das Löschförmchen neben sich. Dies war ein 2 - 3 m langer Stecken, oben daran ein trichterförmiges blechernes Gefäss und ein Köpfchen daran. Damit wurden die Altarkerzen angezündet und abgelöscht. Mit diesem Löschförmchen zwickte er dann und wann während des Betens diejenigen, welche etwa Allotria trieben. Jeder Bube suchte nun in nächster Nähe des Siegristen zu kommen, denn er wurde so weniger zum Possentreiben verleitet und auch weniger von der Zuchtrute getroffen.
Wenn im September der Hanf „Werch“ reif war, so wurde er ausgezogen und auf Matten ausgebreitet bis die Stengel dürr waren. Dann wurden sie in Bürden zusammen gebunden und nach Hause in den Schopf gebracht. Vom Oktober an wurden die Hanfstengel gebrochen „gereitet“ und die Bastfasern von Hand vom Stengel abgezogen. Da musste Alles mithelfen, Eltern und Kinder, es gab keine Fahnenflucht. Die Stengelstümpen füllten bald Küche, Gang und Stube. Das „Wärch“ wurde von der Mutter eingesammelt und dann in einen grossen dicken Zopf geflochten. Das Flechten nahm sie auf dem grossen Stubentisch vor. Dabei durfte eines von uns auf den Zopf sitzen. Wenn der Zopf fertig geflochten war, zog die Mutter denselben mit dem darauf Sitzenden in grossem Bogen herunter, natürlich hielt sie mich bei einem Ärmchen. Wenn aller Hanf „gereitet“ war, und das dauerte viele Tage, denn wir pflanzten jedes Jahr ein grosses Stück Hanf, wanderten die Zöpfe in die Handreibe. Eine solche war eingerichtet in der Mühle in Mumpf. Da war ein kreisrundes Steinbett bis Brusthöhe, zuoberst ganz glatt, etwa zwei Meter im Durchmesser. Mitten darin stand ein runder Mast, daran war ein Arm aus Eisen, dieser steckte in einem Stein, der die Form eines abgestumpften Regals hatte, aussen der dickere Teil. Dieser Stein hatte aussen einen Durchmesser von 1 m. Wenn nun durch Mutterkraft die Walze in Bewegung gesetzt wurde, waren schon etwa 3 Hanfzöpfe auf das Steinbett gelegt und der rollende Stein sauste über die Zöpfe. Eine Person stand immer dabei und kehrte den Hanf fleissig. Dabei musste sie aber beständig auf der Hut sein, damit nicht etwa ihre Finger statt die Hanffasern gequetscht wurden. Wenn nun der Hanf gut weich gerieben war, kam der „Hächler“ an die Arbeit. Dieser zog die Hanffasern durch ein kleines 2 - 3 dm langes, 1 ½ dm breites Gestell. Auf einem Brettchen standen ziemlich dicht in einander Stricknadel dicke 2 dm hohe Stahldrähte, die nach oben spitz ausliefen. Durch diese „Hächel“ zog er Büschel um Büschel die Hanffasern, dadurch gab es feine Fäden. Die längern wurde „Reiste“ geheissen, die kürzern „Zöckli“. Diese beiden Sorten wurden nun von Frauen und Mädchen am Spinnrad gesponnen. Da waren in unserer Stube immer 2 solcher im Winter in Tätigkeit, eines von meiner Mutter, das andere von der Grossmutter. Dabei sangen sie oft zweistimmig alte, bald fröhliche, bald sentimentale Volkslieder wie zum Beispiel „Im
Röseligarten kannst du meiner warten“ etc oder „Rosmarin und grüne Blätter“, „Spielet auf ihr Musikanten“, „Im Aargäu sind zweu Liebi“, und noch andere. Die Grossmutter sang Sopran, sie hatte noch in ihrem hohen Alter eine feine reine Stimme, das „Sopherli“, meine Mutter sang die Altstimme. Wir Kinder sassen am Tische und machten unsere Hausaufgaben oder horchten auf den Gesang. Wenn der Hanf gesponnen war, wurde er auf einem Haspel aufgewunden. Er hiess nun Garn. Die längeren Fasern, die „Reiste“ gab das feinere Garn, die kurzen, die „Zöckli“ das gröbere. Nun wanderte das Garn zum Weber.
In Mumpf gab es zu meiner Zeit keine solchen mehr, aber in Obermumpf. Dieser wob das Garn, aber im Einschlag noch Lammwolle oder sogenannte Neffelgarn darunter. Das gewobene Tuch war noch grau und ruch. Nun wurde es gebleicht, entweder durch Naturbleiche oder mittelst Chlorkalk. Wenn das Tuch gebleicht war, wurde es verwendet zu Leintüchern oder Handtüchern, anderes wurde ich die Färberei geschickt. Aus dem gefärbten Stoff wurden Anzüge für Bett und Kopfkissen gemacht. Solche selbstgepflanzte und zubereitete Stoffe besitze ich jetzt noch. Sie halten länger aus als gekaufte Stoffe. „Wärch“ wird jetzt auch wieder mehr gepflanzt.
Der Flachs wurde nicht „gereitet“, weil die Stengel zu dünn sind. Die Stengel wurden „gerätscht“, wohlverstanden ohne Mundwerk, sondern mit der Flachsbreche auch von Hand, nachdem die Stengel gehörig durchwärmt wurden. Die übrige Verarbeitung geschah wie beim Hanf. Der daraus gewonnene Stoff wurde zu weissen Kopftüchern für die Frauen, für Nastücher, Tischtücher, Hemden, auch Bettzeug verwendet. Die Frauen und auch Mädchen trugen dazumal selten Hüte am Werktag, mehrteils weisse Tücher, die das Ober- und Hinterhaupt deckten.
Mein Vater war, besonders zur Winterzeit, nach dem Nachtessen selten daheim. Nicht dass er etwa ins Wirtshaus ging, sondern in sein Schulzimmer. Das Schulhaus liegt ja kaum 20 Schritte von unserm Hause entfernt. Dort hatte er sich eine Kerze angezündet, korrigierte die Aufsätze und las dann in seinen Büchern, denn der Vater schaffte viele Bücher an. Nachher ging er zum Posthalter, wo noch ein dritter alter Bürger jeden Abend hinkam. Diese drei Männer machten dann noch einen Jass oder Binoggel, jedoch nur mit einem Einsatz von 2 Rappen.
In selbiger Zeit fuhr noch eine Postkutsche von Stein, durch Mumpf und Möhlin bis nach Rheinfelden. Am Postwagen waren 2, oft aber auch 4 Pferde angespannt. Am Morgen um 8 - 9 Uhr kam sie von Rheinfelden her, am Abend nach 8 Uhr von Stein. Am Abend blies der Postillon jedesmal ein Lied auf seinem Posthörnchen, wenn er durch das Dorf fuhr. Das war schön anzuhören, besonders im Winter, wenn es schon lange „Nacht“ war. Wir Kinder wollten dann immer erst ins Bett, wenn der Postillon geblasen hatte.
In meinen Kinderjahren rief der Nachtwächter noch die Stunden von verschiedenen Stellen des Dorfes, gewöhnlich nach je 2 Stunden. Einmal kamen wir 3 Brüder von der Nachtwache nach Hause. Es war punkt 12 Uhr. Da hörten und sahen wir den Nachtwächter in seinem blauen Militärmantel und Kappe mit einem dicken Knotenstock vom Schulhaus herunter gegen die Dorfstrasse stolpern. Da sagten wir: den wollen wir jetzt einmal in der Nähe hören. Wir sprangen gegen ihn zu und stellten uns vor ihn hin. Da stellte er sich in strammer Positur und rief mit mächtiger etwas trübseliger Stimme: „O hört, was ich Euch will sage, die Glogge hat zwölfi gschlage, zwölfi gschlage.“ Dann aber sagte er barsch zu uns: „Wo chömed ihr här, Buebe? Machet ass er hei is Bett chömet!“ Wir entschuldigten uns damit, wir seien auf der Nachtwache gewesen, gingen dann aber flugs heim. Der Nachtwächter war jede Nacht im Schulhaus in einem besonderen Kämmerchen, worin er auf einer Pritsche schlief, dort brannte auch die ganze Zeit ein Öllicht. Der Nachtwächter hatte dann auch im Winter die Schulzimmer zu heizen.
Unser Schulzimmer hatte einen braunen viereckigen Kachelofen. Die Schulbänke waren vierplätzig. An den Wänden hingen ein Ölbild der zwei Pfarrherren Vögeli und Rüegg. Von Veranschaulichungs-Lehrmitteln wie Zählrahmen oder gar Lesetabellen war noch nichts zu sehen. An den Wänden hingen noch zwei Landkarten: Europa, Schweiz, glaube kaum eine Aargauerkarte. Trotz der wenigen Bilder und Anschauungsmittel lernten wir doch lesen, schreiben, rechnen, was jetzt doch noch im Leben die Hauptsache ist.
daneben das Archiv. Zuunterst waren nebst der Wächterkammer 2 Arrestlokale, in die wir von der Nebenstrasse aus auch hineinguckten, wenn diese beherbergt waren. Von einem Turnplatz war noch keine Rede, Turnen wurde überhaupt nicht erteilt, es figurierte nicht unter den Lehrfächern.
Der Vater war, solange ich bei ihm die Schule besuchte, Gesamtlehrer. Er hatte immer 8 Klassen, oft mit 80 - 90 Kindern zu führen. Jedes Vierteljahr erhielt er auch seine Besoldung mit 250 - später 300 Franken. Der Schulfondverwalter brachte ihm den „Zapfen“ selber und ziemlich rechtzeitig.
Ein Ereignis war für uns auch die Jahresprüfung. Vorher wurden zwei Tannenbäumchen je links und rechts vom Schuleingang aufgestellt mit Kränzen geziert. Das Schulpult war geschmückt mit Blumen und einem Kranze. Man hielt selbiges Mal noch recht viel auf einer Schulprüfung, es war dies auch ein gutes Zeichen der Bevölkerung. Der Schulinspektor war ein würdiger, stramm daher schreitender, grosser Pfarrherr Herzog von Wegenstetten, gebürtig von Möhlin. Wir Schulkinder hatten Ehrfurcht, aber auch Liebe zu ihm. Nach der Schulprüfung standen bei der Post, die ganz nahe beim Schulhaus ist, zwei grosse hohe Körbe voll letztjähriger Äpfel. Sobald die Schüler das Schulhaus verliessen, wurden vom Posthalter oder deren Frau die Obstkörbe umgestülpt und die Äpfel verteilten sich auf Hausplatz und Strasse. Wir Schulkinder stürzten nun über die Äpfel her, jedes suchte natürlich so viel als möglich von den guten Dingerchen zu erhaschen. Ein anderes Prüfungsgeschenk gab es nicht.
Während meiner Schulzeit wurde ein einziges Jugendfest gefeiert und zwar mit der Schule von Wallbach auf dem „Kapf“, das ist eine Anhöhe oberhalb der Mühle Mumpf, östlich von der Obermumpferstrasse. Dabei blieb der Schulpflegspräsident von Wallbach, Bezirksrichter Kaufmann schon am Anfang in der Festrede stecken.
Mit der erwähnten Nachtwache verhielt es sich so: Wenn eine erwachsene Person in der Gemeinde gestorben war, so hielten die Nachbaren, nächsten Verwandten und Bekannten die Nachtwache in der Wohnstube des Verstorbenen. Das gab gewöhnlich eine ganze Stube voll. Da wurde gebetet auswendig oder nach einem Gebetsbuch. Dazwischen gab es wieder Pausen, in denen geplaudert wurde. So um 10 Uhr gab es etwas z’Nüni: Wein und Brot. Most wurde nicht aufgetischt, es gab eben weniger Most als Wein. Die meisten Nachtwachen gab es darum Vormitternacht, wegen dem z’Nüni, Nachmitternacht wurden die Ersteren abgelöst durch andere Beter, da gab es schon weniger, weil es nicht mehr zu trinken gab. Die Verstorbenen wurden, wie jetzt noch in Mumpf, von 4 Männern oder Jünglingen, wenn es eine ledige Person war, auf den Gottesacker getragen. Auch die Leichen von Wallbach wurden dahin getragen. Erst als die Gemeinde Mumpf einen neuen Friedhof unterhalb des Dorfes erhielt, bestellten auch die Wallbacher für ihre Gemeindeangehörigen einen eigenen Friedhof. Diese Veränderung geschah in den neunziger Jahren.
Der Verkehr und Handel war noch sehr einfach. Da noch keine Bahn fuhr, musste durch Fuhrwerke alles geholt und versandt werden. Es kam in der Woche ein gewisser Horlacher von Brugg mit seinem grossen Pritschenwagen, oft auch ein zweiter angehängt, von 4 schweren Pferden bespannt, durch die Gemeinden des Fricktals längs der Landstrasse bis Basel. Jeden Donnerstag kam er von Brugg her über den Bötzberg nach Basel. Im Gasthaus zur „Sonne“ in Mumpf machte er Mittagsrast, auf dem Rückweg ebenfalls. Am Samstag kam er dann von Basel her. Wagen und Pferde hatten Glöcklein. Das war für uns auch wieder ein Ereignis, weil ja sonst wenige Fahrzeuge zu sehen waren, ausser zur Herbstzeit bei der Obsternte und Weinlese.
Pferde hatten dazumal bloss die Gasthofbesitzer zum „Bad“, „Adler“ und „Sonne“. Denn es war oft Vorspann nötig für den Steiner „Stich“ und die Möhliner „Höhe“. Über diese letztere Anhöhe wollte aber von Mumpf niemand gern zur Nachtzeit Vorspann leisten, wegen dem „Fritz Böni Geist“ auf der Höhe. Gar mancher wollte diesen schlimmen Gesellen gesehen haben, auch Flösser, die von Basel her noch spät in der Nacht heimkehrten. Von Letztern kann man dies begreifen, da sie ja sehr ermüdet waren von dem langen Marsch oder dann noch zu tief ins Glas, nicht Fernrohr geguckt haben. Item. Alle kamen heil vom Fritz Böni fort. Einem Fuhrmann rannten einmal, der Vorspann geleistet, seine 2 Pferde querfeldein bis in den Wald „Kiesholz“ hinunter, wo sie plötzlich stehen geblieben und der Reiter erwachte, aber den bösen „Geist“ hat er nicht mehr gesehen.
Freuden brachte uns, wie jetzt noch, der Winter. Wenn tiefer Schnee lag, hatten wir prächtige Schlittelwege, so einer von der Obermumpferstrasse bis zur Landstrasse hinunter wohl 1 km lang, andere kürzere Bahnen zweigten davon ab. Nur erster Schlittweg bot für uns oft ein Hindernis, indem etwa ein Anwohner der Strasse drohte, uns den Schlitten zu zerschlagen, wenn wir nicht aufhören würden. Aber wir schlittelten
weiter. Ich habe schon manche Dorfjugend bedauert, die keine schönen Schlittelwege besitzt, wie z.B. Möhlin. Ski waren damals noch nicht geboren, ebensowenig Schlittschuhe. War es gefroren, konnte man auf dem Rhein glitschen „schliefern“, denn es war ungefährlich, weil der Wasserstand ganz gering war. Franz Waldmeyer zur „Sonne“ holte sich Eisblöcke aus dem Rhein und brachte diese in seinen neu erbauten Eiskeller beim Gasthaus.
In damaliger Zeit gab es noch grosse ausgedehnte Weinberge. So hatten Zeiningen, Magden, Olsberg, Obermumpf, Wallbach und Mumpf ein grosses Rebgebiet. Wir hatten 3 Äcker mit Weinreben, ein Stück lag westlich der Strasse von Mumpf nach Zuzgen, die andern zwei Stücke lagen an der „Katzenfluh“, eines am obern Abhang, das andere tiefer unten gegen den Bach hin. Darum können wir alle Wein trinken. Aber so ein Stück Reben gibt während des Jahres recht viel Arbeit. Zu meiner Jugendzeit wurde aber diese anstrengende Weinbergsarbeit auch wirklich bezahlt. Man konnte sehr oft Wein verkaufen, so auch wir und dann hatten wir das ganze Jahr vollen Rebensaft im Keller, nicht angemachte Ware. Wir konnten so 5 - 6 Saum (1 ½ hl) einkellern. Arbeit gab es vom Frühling bis in den Herbst hinein. Schon im März wurden die Reben beschnitten, dann das Grundstück mit Karst behackt. Letztere Arbeit war schwer, da der Boden viel Letten mit Kalk hat. Am untern Ende eines jeden Grundstückes wurde quer durch ein ca. 3 dm tiefer und 4 dm breiter Graben aufgeworfen. Das so ausgeworfene Erdreich mussten meistens wir Kinder mit Hutten (Tragkörbe) und Körben zuoberst in das Grundstück tragen. Bis zum Herbst waren dann die Gräben doch wieder vom herunter geschwemmten Erdreich ausgefüllt. Diese Arbeit nannte man „Vorfälli“ tragen. Während des Sommers musste man fleissig die unnötigen Schosse von den Reben wegnehmen und Grund und Boden öfters behacken.
Wenn die Trauben bald reif waren, wurde das Betreten des Weinberges verboten. Nur jeweils am Samstag durfte der Rebbesitzer in sein Grundstück, um die nötigste Arbeit vorzunehmen. Der ganze Weinberg war während dieser Verbotzeit streng bewacht. Durch Gemeindebeschluss wurde nun der „Herbstet“ oder das Traubenlesen bekannt gegeben. Da gab es nun eine freudige Zeit, besonders für uns Kinder. Am nächsten Morgen schon wurden die Standen, Zuber, „Bücki“ (Tanse) gesäubert, Messer und Rebscheren geschliffen. Die Standen und Bütten (Bottiche) wurden auf grossen und kleinen Wagen fest gebunden. Wagen und Geschirr darauf mussten festhalten, da der Weg nach dem Weinberg steil und holperig war. Hinauf wurden Zugtiere angespannt, hinunter leitete man den beladenen Wagen selbst. Im Weinberg gab es frohes Leben. Es wurde geschossen, gejauchzt und Trauben gegessen bis man satt war und dann sehr wählerisch im Beerenessen, aber auch „faul“ zur Arbeit. Dürre und faule Beeren musste man fein säuberlich daraus machen. Die gefüllten Zuber und Kessel wurden in das „Bücki“ geschüttet und das gefüllte von Vater oder Sohn auf den Wagen in die Standen geschüttet. Den ganzen langen Weinberg entlang standen Wagen an Wagen. Man ging erst heim, wenn das ganze Rebstück „gewimmet“ war. Da gab es nur kalten Tisch: Brot, Käse und Wein. Nun wurde der beladene Wagen ins Dorf hinunter zur „Trotte“ oder
Kelter geführt. Einmal wurde ein mit zwei gross gefüllten Bottichen Wagen bei einer Kehre umgeworfen und der Wagen samt der süssen Last in den Wald hinunter geworfen, so dass wenig Trauben mehr zu erhalten waren.
In der Trotte fanden wir Buben uns fleissig ein, denn es gab da Trauben zu essen und jedermann, der solche auspresste, gab uns auch von dem süssen Traubensaft zu trinken. Man nahm es in dieser Hinsicht nicht so genau. Wir konnten für uns daheim immer genug einkellern für das ganze Jahr, Wasser wurde keines zugesetzt, es gab also noch volles Hausgetränk. Oft konnten wir auch Wein verkaufen. Der alte Saum (150 l) galt dazumal 29 - 35 Franken.
In selbiger Zeit sah und hörte man längere Zeit Tag und Nacht Weinfuhren durchs Dorf, da von Basel aus im obern Fricktal Wein geholt wurde, da keine Eisenbahn existierte. Da geschah es oft, dass solche Weinfuhren in Mumpf übernachteten. Das benutzten einige schlimmen Kerle, steckten wenn Mann und Ross im Stall schliefen einen Schlauch oben in das Weinfass und leiteten diesen in eine grosse Korbflasche, die bereit gestellt und nachher in ein Nachbarhaus geschafft wurde. Ich habe nie von diesem Wein genossen.
Im Herbst galt es auch, das Getreide zu dreschen. Dies geschah aber noch mit Flegeln, nämlich mit leblosen aus Holz. Da kamen die Drescher schon vor Tagesanbruch zum Haus und fingen dann an zu dreschen, zu drei oder vier. Zum Morgenessen erhielten sie eine dicke Mehlsuppe und Milchkaffee. Z’Nüni gab es Wein, Speck, Brot, mittags tüchtige Hauskost, z’Obig wieder Wein oder Schnaps (voller), zum Nachtessen Suppe, frische Birnen und Kaffee. Es wurde bei Laternenschein noch gedroschen. Der Taglohn pro Mann betrug 80 Rappen. Wir hatten im Winter auch einen Kurzfutterschneider für das Vieh dann und wann zur Arbeit. Der kam von Wallbach her schon vor Tagesgrauen und schnitt bis in die Nacht hinein Heu, Stroh, Klee und verlangte pro Tag auch bloss 80 Rappen, später 1 Franken. Auf die Stör zu den Kunden gingen dazumal auch Schneider, Schuster und Schneiderin bei bescheidenem Tageslohn.
Als Beleuchtung im Hause gab es Öllämpchen, sogenannte Pumper, in denen man das Öl in das Lämpchen heraufpumpen konnte. Es war Öl von Lewat (Anm.: Raps), der in ganzen Äckern gepflanzt wurde. Wir hatten viele Jahre solche Ernte. Spätere Beleuchtungsmittel waren die Kerzen. Petrollicht kannte man erst später. Ich erinnere mich noch gut, wie mein Vater für unsere Stubenbeleuchtung die erste Petrollampe von Basel heimbrachte, als er dorthin einen Floss geführt hatte. Das Petrol war aber auch teuer, es kam das Öllicht billiger zu stehen. Doch konnte man bei der Petrolbeleuchtung besser sehen, man schonte also die Augen. Unsere Lampe war eine der ersten im Dorfe. Mit der Petrolbeleuchtung wurden dann einige Jahre später auch Strassenlaternen aufgestellt und mit Petrol gespiesen. In Küche, Scheune und Stall benützte man aber noch viele Jahre Laternen mit Öllicht. Nun leuchtet das elektrische Licht in der ärmsten Hütte und im prachtvollsten Palast, sowohl im Tal wie auf den höchstgelegenen Wohnungen. Unsere Schlafstätten daheim waren höchst einfach: Eine Bettstelle aus Tannenholz, zuunterst im Bett war ein Strohsack, der jedes Jahr einmal eine neue Füllung erhielt. Darüber lag ein Sack mit Spreu gefüllt, auf dem man aber auch gut schlief. Über diesen wurde ein Leintuch ausgebreitet. Ein Oberleintuch gab es nicht. Über sich hatte man auch ein Federdeckbett. Matratzen und Teppiche kannte man in jener Zeit nicht, solches gehörte zum Luxus. Im Winter, wenn es recht kalt wurde, hatte man zu Füssen im Bett ein Säcklein, das mit Kirschensteinen gefüllt und gewärmt wurde. Die „Chriesistei“ holte man bei einem Bauer, der Kirschwasser brannte. Wir drei Brüder schliefen in einer Kammer, die aber nicht geheizt werden konnte. Wurde es nun sehr kalt, so wurde zuhinterst im Viehstall ein Bretterverschlag errichtet und darin ein grosses Bett gestellt, worin wir Nacht für Nacht schliefen und zwar mit Vergnügen, es war warm, wir standen erst auf, als Vater oder Mutter uns heraus trommelten.
Das Gasthaus zur „Glocke“ kam zur Berühmtheit durch die Wallbacher Kirchgänger. Die Bewohner von Wallbach waren ehedem kirchengenössig in Mumpf. Sie hatten somit das Vergnügen, jeden Sonntag nach Mumpf in die Kirche zu pilgern. Kam einer etwa zu spät dahin, so entschuldigte er sich damit etwa daheim: er habe im „Gloggehus“ noch Unterkunft gefunden. Dieses „Gloggehus“ ist der hinterste Teil der Kirche. Diese Nachzügler standen aber während des Gottesdienstes nicht dort, sondern sassen in der „Glocke“. Das Gasthaus zur „Sonne“ wird wohl das älteste in Mumpf sein. Daselbst wurde die berühmte französische Tragödin Rachel geboren. Alle vier Gasthöfe: Sonne, Glocke, Adler, Anker, hatten früher grossen Zuspruch von Fussgängern und Fuhrwerken Tag und Nacht, weil an der Landstrasse Basel - Zürich gelegen. Auch Wallfahrer von Frankreich und Elsass pilgerten besonders zur Sommerszeit fast jeden Tag durch unser Dorf, sie trugen graue aufgeschürzte Kleidung, höchst einfach in Mode. Wir Kinder bettelten sie an um eine „Mutter Gottes“. Solche brachten sie von Einsiedeln her, eine Madonna in Erde gemacht, kaum fingerlang und zwei fingerbreit. Solche Amulet teilten Pilgerinnen von Einsiedeln kommend unter uns Kindern aus. Männer sahen wir sehr wenige.
Öffentliche Anlässe gab es in meiner Jugendzeit in Mumpf nicht. Ein einziges Mal, soviel wie ich mich erinnere, wurde „theäterlet“ und das war das Stück „Genovefa“. Konzerte oder Abendveranstaltungen, noch viel weniger religiöse Familienabende, wie sie jetzt von christkatholischer, römischkatholischer oder protestantischer Seite abgehalten werden, wusste man gar nichts. Doch waren die Leute ebenso fromm, wie heutzutage, vielleicht noch frömmer im alten Sinn. Aber statt der Konzerte hörte man da und dort vor einem Hause von Mädchen und auch Knaben anständige Lieder der Heimat und des Vaterlandes singen, was man jetzt auf Dörfern nicht mehr hört, trotz der Verordnung von oben, dass alljährlich 4 Lieder in Text und Melodie in allen Schulen gesungen werden müssen, nein: unverschämte Gassenhauer erschallen bis in tiefe Nacht durch die Strassen.
Für Verschönerung des Dorfes wurde in früher Zeit sehr wenig aus gegeben. Die Häuser behielten Jahre lang ihren ersten Anstrich, gekünstelt wurde daran nicht viel. Auch die Wohnungen selbst behielten ihr altes Kleid: Böden aus breiten Tannenbrettern, die jede Woche, Samstags gefegt und mit feinem Sand bestreut wurden. Decke und Wände waren meistens vertäfelt, darum warme Stuben. Fast in jeder Stube stand ein Kachelofen, um denselben eine Holzbank, über derselben war in der Decke ein viereckiges Brett, das gehoben werden konnte. Durch diese Lücke schlüpfte man nachts in die obere Kammer, wenn man schlafen gehen wollte. Rings um den Ofen war oben ein Vorhang. Neben dem Ofen war die Kunst aus Kacheln. Darin wurde auch der Rest des Mittagsmahles gestellt, der dann zum z’Obig genommen wurde. Oder es wurden darin Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Kirschen gedörrt. Das Kerzen- sowie das Öllicht mussten von Zeit auf geputzt werden, nämlich der kohlende Docht mit der Lichtputzschere geschneuzt (Anm.: gekürzt).
Die Feldarbeiten wurden in meiner Jugendzeit alle mit der Hand verrichtet. Da gab es noch keine landwirtschaftlichen Maschinen. Im Heuet und Emdet da gab es viel zu mähen. Am Morgen von 2 Uhr an hörte man Mähder durch das Dorf nach dem Winterfeld gehen. Es wurde gemäht bis der Komplex sauber rasiert war. Inzwischen ein kräftiges z’Nüni. Am Nachmittag kehrte man mit Gabel oder Rechen das Futter. Am Abend machte man Schochen. Am andern Tag zerstreute man das Futter wieder. Wenn es dürr geworden, ging einer von uns heim und holte den Wagen mit den Kühen. Denn wohlverstanden, zu Ochsen oder Pferden haben wir es in unsern Verhältnissen nie gebracht. Zu Hause wurde das Heu beim Abladen noch von einem von uns tüchtig gestampft, was keiner sehr gern tat, denn die Hitze auf dem Heustock war fast unerträglich. Bei der Fütterung durfte aber das Futter nicht oben abgenommen werden, sondern es wurde mit einem sogenannten Heurüpfel heraus gezogen, Handvoll für Handvoll. Dieses Instrument bestand aus einem meterlangen Stiel aus Holz, vorn daran war aus Eisen ein Haken, ähnlich einem Angel, diesen steckte man in des Futter und zog ihn wieder zurück. Unter das Emd streute man beim Abladen das Stroh von der Gerste, damit es nicht zu schwer auf einander lag und sich weniger entzündete. In solche Emdstöcke hatten wir alsdann im Herbst auch aufgelesenes Obst gesteckt, denn es blieb gut erhalten und gab im Winter billige Zukost, zu unserm schmalen Zobig. Denn ich gestehe gern, dass wir oft hungerten. Denn das Brot war selbigsmal recht teuer: 1 Fr. - 1 Fr.20 Rp. der Laib. Wir mussten jedes Jahr vom Frühling an bis zur Ernte Brot kaufen, das war dann eine grosse Auslage für eine 7köpfige Familie, die alle gesund waren bei einer mageren Schulmeisterbesoldung.
Bei der Ernte wurde alles Getreide mit der Sichel geschnitten. Der Meister unter den Schnittern und Schnitterinnen hatte die Aufgabe, fleissig die Sicheln zu wetzen. War ein schöner Tag, so rückte am Morgen alles zeitig aus, mit Kind und Kegel, um den Getreideacker noch vor Abend niederzulegen. Damals trugen die Frauen ihre kleinen Kinder in einem länglichen Korb, Zeine genannt, auf dem Kopfe aufs Feld und heim. Kinderwagen kannte man in unserer Jugend noch nicht. Später wurde dann das Getreide auch mit der Sense abgemäht. Da begegnete mir wieder ein Unfall. Der Vater stellte die Sense an den Boden. Ich hatte ihm auf dem Acker etwas zu holen. Beim Rückweg sah ich nicht vor mich hin und rannte mit dem rechten Bein in die Sense. Das gab einen tiefen Schnitt bis auf den Knochen und noch in diesen. Die Mutter trug mich mehr als führen an den nahen Rhein hinunter, wusch und verband mir die Wunde, wonach sie mich heim brachte. Ich hatte manche Woche an diesem Übel zu leiden. Die Narbe des Schnittes ist jetzt noch recht deutlich unten im rechten Schienbein.
In meinen Knabenjahren waren jeden Sommer kirchliche Prozessionen. Damit gingen Kinder und Erwachsene. Auf dem Wege wurde immer gebetet. Wir Knaben beteten am kräftigsten, wenn es durch den Wald ging, da wir gerne unser Echo hörten. Diese Prozessionen gingen oft weit. Von Mumpf aus hatten wir jedes Jahr einen solchen Bittgang auf der Landstrasse bis auf die Möhliner Höhe, von da durch das Feld nach Wallbach und wieder nach Mumpf. Ein zweiter Bittgang war nach Obermumpf, ein dritter nach Wallbach, ein vierter durch den Wald, den Rebberg bis zur Katzenfluh hinauf. Jedesmal hielt der Pfarrer dabei eine Predigt. Man ging stets einer hinter dem andern am Rande der Strasse in zwei Reihen, so dass die Mitte der Strasse frei war. In dieser ging der sogenannte Stecklimeister, der unter der Jugend Ordnung halten musste. Es waren bei jedem Bittgang vier Haltstellen, wo der Pfarrer ein Stück des Evangeliums las und der Kirchenchor ein Lied sang. Bei einem solchen Halt riss ich bei dem Rande des Ackers eine Ähre ab, um sie zu zerreiben und die Kerne zu öffnen. Da kam ein Wallbacher Bursche herbei und versetzte mir eine Ohrfeige, dass mir Hören und Sehen verging. Diesen Rohling hatte ich aber stets im Gedächtnis.
War ein Mensch schwer krank, so dass man mit seinem Ableben rechnen musste, so spendet ihm der Pfarrer das letzte heilige Abendmahl. Dabei kam er in kirchlichem Ornat, ebenso der Siegrist oder Küster, letzterer trug eine brennende Laterne und ein Glöcklein. Kam ein Mensch in Sicht, so klingelte er und die betreffende Person kniete nieder und bekreuzte sich.
Auch wurden Wallfahrten unternommen. Von Mumpf aus fanden fast jeden Sonntag von einzelnen Personen solche Pilgerfahrten statt zum hohen Kreuz, zwischen Schupfart und Wittnau. Auf dem Buschberg stand ein Kreuz, um dasselbe waren Bänke aufgeschlagen. Auf diese setzten sich die Wallfahrer und beteten still vor sich hin. Ich nahm als Schulknabe mehrmals an einer solchen Wallfahrt teil mit meiner Mutter selig. Auf dem Rückweg wurde in einer Ortschaft auch eingekehrt und etwas Zobig genommen.
Auch das Schatzgraben wurde damals von einem Mumpferbürger versucht, in dem Wäldchen südlich von Mumpf zwischen dem Zuzger- und dem Obermumpferweg. Dieser ging nachts mit einigen andern Bürgern dorthin mit einem grossen Leintuch und Kräutern. Aber vergebens wiederholten sie diesen Hokuspokus. Der Unternehmer war ein Junggeselle, seine Gehilfen leisteten ihm gern Dienste gegen Bezahlung oder leibliche Erquickung.
II. Periode
Nachdem ich 5 Jahre die Gesamtschule in Mumpf unter meinem seligen Vater besuchte, meldete ich mich in die Bürgerschule Säckingen. Diese Schule entsprach so unschwer jetziger Fortbildungsschule mit einem Hauptlehrer, ein Hülfslehrer und den Religionslehrer. Der Hauptlehrer war Herr Villinger, ein wahrer Pestalozzijünger, schon ein älterer Mann, der besonderes Gewicht auf die Erlernung der Sprache und auf eine schöne Schrift legte. Bei diesem Lehrer lernte man wahrhaft schön schreiben. Aus Mumpf besuchten noch Josef Waldmeier, späterer Sonnenwirt, Gotthold Güntert, später auf der Zivilgerichtsschreiberei Basel, beide schon gestorben und Adolf Schlienger zu gleicher Zeit diese Schule. Aus Obermumpf kam Karl Stocker, später Lehrer in Oberwil, Baselland. Von Wallbach her kamen Alfred Wunderlin, mein späterer Schwager und Friedrich Lenzi, der nachmalige Adlerwirt, beide auch vorangegangen. Von Stein kamen zwei Schüler: Julius Stutz, Löwenwirts und Josef Tröndle, später Postbeamter. Von Münchwilen kam ein Julius Moosmann. Alle diese Schweizer liebte unser Hauptlehrer sehr. Er stellte uns stets als Musterschüler vor, währenddem er die Säckinger als deutsche Michel und Pflastertreter titulierte.
Wir Mumpfer und Wallbacher nahmen das Mittagessen von daheim mit in einer Tasche. Rucksäcke gab es dazumal noch nicht. Unsern Proviant durften wir im Schulzimmer hinter den grossen eisernen Zilinderofen stellen, da wurde der Imbiss bis Mittag schön warm. Über die Mittagszeit waren wir Schweizer dann allein im Schulzimmer bei unserm Essen. Den Städtlern war es aufs strengste verboten, das Zimmer vor Schulbeginn zu betreten. Einzig Josef Waldmeier nahm das Mittagessen in einem Privathaus. Er kam aber rechtzeitig stets in unsere Klause zurück, um noch etwas Allotria zu treiben. Jedesmal bei Schulschluss wurde noch ein Gebet gesprochen, dann eingepackt Buch und Stift, dann standen alle auf und grüssten zum Abschied den Lehrer mit dem Wunsch: „Behüt Sie Gott Herr Lehrer!“ Dann verabschiedete er uns. Der Hülfslehrer Müller war Kaplan und erteilte Unterricht in der französischen Sprache. Er war nicht so beliebt, weil er sich über uns gern lustig machte und spöttelte. Ein anderer Lehrer Volmar gab Unterricht im Zeichnen, aber er steckte das Ziel in seinem Unterricht zu hoch.
Die Mumpfer und Wallbacher benutzten die Rheinfähre in Mumpf. Im Sommer begann der Unterricht um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr. Von der Fähre aus am badischen Ufer hatten wir immer 3/4 Stunden bis zum Schulhaus. Dieses stand östlich von der Stadtkirche, wo jetzt noch das Amtshaus ist. Weil wir schon so früh in der Schule uns einzufinden hatten, hiess es früh aufstehen. Etwas nach 6, eventuell nach 7 Uhr standen wir schon im Fährschiff, Mumpf und Wallbach aufeinander wartend. Wir kamen aber auch höchst selten, etwa im strengen Winter, ein wenig zu spät zur Schule. In dieser Hinsicht rühmte uns der Oberlehrer Villinger stets! Aber im Winter, wenn Treibeis (Grundeis) auf dem Rhein war, dann konnte das Fährschiff nicht benutzt werden. Da mussten wir über Stein nach Säckingen wandern, das war ein Weg von 5/4 Stunden, dazu der scharfe Biswind, der uns von Stein bis Säckingen durch die Knochen blies. Denn dazumal hatte man noch kein Mäntelchen und keine Pelerinen, nur unsere diversen Kleider. So hatten wir oft 2-3 schwere Tage nacheinander. Dann durften wir aber im Schulzimmer zum Ofen stehen.
Der Rückweg von Säckingen war für uns der schönste Vergnügungszeitpunkt. Im Sommer winkten uns die rotbraunen und schwarzen Kirschen von den am Wege stehenden Bäumen herunter. Die Flurpolizei wurde streng gehandhabt, selbst die badischen Grenzwächter verwarnten uns auch etwa, wenn die Schweizerbuben gar frech wurden, aber verzeigt oder gar gestraft wurden wir nie. Das Schulgeld betrug für ein Jahr für jeden auswärts wohnenden Schüler sechs Gulden (1 Gulden = 2 Fr 20 Rp). Die Lehrmittel und Schulmaterialien hatten wir selbst zu besorgen. Als französisches Lehrbuch hatten wir das von F. Ahn, als deutsches Geschichtsbuch das von Beck, als Lesebuch „Der süddeutsche Schulfreund“, ein Geographiebuch hatten wir nicht, es wurde die Geographie des Grossherzogtums Baden von Lehrer Villinger doziert. Die biblische Geschichte nach Christof Schmid behandelte der Stadtpfarrer. Musikunterricht nahm nur ein Schüler von uns und zwar Jakob Gersbach von Wallbach im Flötenspiel.
Eine Zeitlang ass ich zu Mittag mit Bruder Philemon, der damals in der obern oder alten Fabrik arbeitete. Das Mittagessen wurde uns von daheim dorthin gebracht. Dort sah ich auch zu, wie die Seidenbänder gewoben und zwischen zwei grossen hohlen Walzen durchgelassen wurden. In die Höhlung der Walzen wurden rotglühende Kugeln gebracht, damit das Walzwerk immer heiss war. Zu meiner Schulzeit gab es in Säckingen drei grosse Seidenfabriken: Die „neue“ Fabrik zunächst westlich von der Stadt, die „alte“ Fabrik am Weg zum Berg her, die Seidenfabrik von Kern ausserhalb der Stadt gegen Obersäckingen hin,ferner war an der Strasse gegen Egg eine Fabrik, in der Nastücher und Bändel gewoben und bedruckt wurden, diese gehörte einem Säckinger Bürger, die andern drei den Gebrüdern Bally und Kern, alle Schweizerbürger, natürlich gaben die Möhliner Urban und Anton Kim ihr überflüssiges Geld auch an die Gebrüder Bally ab. Es fanden damals viele Hände aus Wallbach, Mumpf, Zeiningen, Zuzgen, Obermumpf, Stein, Schupfart Münchwilen, Eiken Sisseln, Arbeit in den verschiedenen Fabriken und Geschäften. Meine liebe Elise und Schwester Blanka arbeiteten auch längere Zeit daselbst.
Ich hatte auch Gelegenheit, das sogenannte „Heidewibli“ kennen zu lernen. Es war dies ein Weiblein von Egg, das trug Pumphosen, eine braune Jacke und eine schwarze Zipfelkappe. Es brachte mit seinen Ochsen, die mit dem Kopf mittelst eines Joches den Wagen zogen, Langholz an dem Rhein herunter zu flössen. Das Weiblein rauchte stets aus einer langen Pfeife. Trinken und fuhrwerken konnte es besser als mancher Mann. Der damalige Grossherzog von Baden schenkte ihm eine kostbare Tabakspfeife.
Unser Schulraum war hinter dem jetzigen Amtshaus, die übrigen Schulen waren im jetzigen Amtshaus untergebracht, der neue Schulhausbau existierte damals noch nicht, auch das Scheffeldenkmal beim grossen Brunnen noch nicht. Meine Schulzeit in Säckingen fiel in die Jahre 1869 und 1870, das heisst bis zum Beginn des deutsch-französischen Krieges. Vom September 1870 an hiess es für uns Schweizer: daheim bleiben! Nun betrat ich einen neuen Weg zur Weiterbildung.
III. Periode
Es wurde durch Adrian Schmid, Hausvater an der Pestalozzistiftung Olsberg den Lehrern im Fricktal bekannt gemacht, dass die Schweizer Gemeinnützige Gesellschaft beabsichtige, Lehrer für Armenanstalten der Schweiz in einem besonders für diesen Zweck geeigneten Institut heran zu bilden. Als Lehrerbildungsanstalt hiefür war die Bächtelen bei Bern ausersehen. Es waren dort vor mir schon eingetreten folgende Fricktaler: Gotthold Güntert, Geschwisterkind (Anm.: Vetter, Neffe oder Cousin) zu mir, Theodor Lenzi von Wölflinswil, später Lehrer in Zeiningen und Anstalt Olsberg, ein Hohler aus Zuzgen, später Lehrer im Elsass, ein Rüetschi von Oberfrick, der, ein Autodidakt, die Prüfung in der Sprache bestand und als Bezirkslehrer in Rheinfelden angestellt wurde.
Mit mir traten im Oktober 1870 in der Bächtelen ein: Josef Mettauer von Gipf, Franz Keller von Hornussen und Ferdinand Hürbin von Wegenstetten.
Da standen wir auf einmal vor einem mit Petrollampen erleuchteten Raum. Ich schaute durchs Fenster. Es war ein Schulzimmer. Drinnen sassen oder standen die grossen Schüler. Ich erkannte sofort darunter meinen Vetter Gotthold Güntert. Alle Schüler trugen grüne Schirme aus Pappe über den Augen, sie konnten diese Schirme an einem Pappstreifen über die Stirne herunter ziehen bis über die Augen. Wir trugen dann später auch solche. Ich trat in das Lehrzimmer. Mein Vetter sah mich erstaunt an und führte mich dann zum Anstaltsdirektor Kuratli. Der war mit seinem Stellvertreter und Hauptlehrer und dessen Frau in einem behaglichen Wohnzimmer.
Kuratli war Junggeselle. Er stammte aus dem Kanton St. Gallen. Er war eine behäbige untersetzte Gestalt, nicht sehr einnehmend oder sympathisch. Er forderte nun meine Schriften und Zeugnisse ab.
Nun war ich in der Bächtelen installiert. Dieselbe liegt ausserhalb Wabern, auf der rechten Strassenseite gegen Thun. Sie ist etwa 5 Minuten von der Strasse gegen den Gurten hin. Die Anstalt, drei Hauptgebäude und Scheune mit Stallungen liegen eben, ganz am Fusse des Gurten. In einem Bau waren unsere Wohn- und Lehrzimmer, in den andern Gebäuden waren die Anstaltsbuben in sogenannten Familien untergebracht. Bächtelen war nämlich eine Erziehungsanstalt für verwahrloste reformierte Knaben. Diese waren drei Lehrern der Anstalt in besondern Wohnräumen unterstellt. Jeder Lehrer hatte seine Schüler oder Zöglinge zu unterrichten und bei den Feldarbeiten zu beaufsichtigen. Die Anstalt besass nämlich ein grosses Landgut, das von der Strasse an bis an den Gipfel des Gurtens hinauf sich ausdehnte.
Dieses grosse Gut hatten die Anstaltsbuben und wir Lehrerzöglinge allein zu bearbeiten. Wir hatten nämlich während des Sommers nicht gar viel Unterricht. Denn bis im Frühling das grosse Gut angepflanzt, im Sommer geheuet, geerntet, geemdet und im Herbst Kartoffeln und anderes Gemüse eingeheimst war, gab es Arbeit in Hülle und Fülle. Es waren nämlich nur 32 männliche Dienstboten eingestellt, die hatten nur Vieh und 2 Pferde zu besorgen. Ich hatte einen ganz besonderen Dienst.
Wenn meine Kameraden zur Feldarbeit ausrücken mussten, behielt mich der Hauptlehrer Schneider zurück. Mir wurde eine kleine Hutte (Tragkorb) angehängt. Damit musste ich nach der Bundesstadt wandern, oft 2 mal oder mehr in der Woche, um verschiedene Sachen für den Haushalt einzukaufen, oder die Mitglieder der Bächtelenkommission zu einer Konferenz einzuladen. Da galt es einen Bondeli, Postdirektor, einen Oberst Wurstemberger, die 2 reformierten Pfarrherren Güder und Baggesen und andere einzuladen. Es wurde mir nur die betreffende Gasse angegeben und fortgeschickt: da such! Es nimmt mich jetzt noch wunder, wie ich alle diese Herren und Geschäfte so leicht auffinden konnte in der grossen Stadt Bern, die mir ja bis dahin fremd und unbekannt war. Aber jeden Auftrag konnte ich ausrichten, kein einziges Mal kam ich eines unverrichteten Dinges wegen heim. Auch konnte mir nie ein Verweis erteilt werden.
Man übergab mir auch Gelder, die ich auf der Post oder in einer Geschäftsstelle einzuzahlen hatte. Damals aber wurden auch grosse Beträge mit oder in Gold oder in 5 Fr. Stücken einbezahlt. Einmal hatte ich in einer Filiale Fr.600.— abzugeben. Herr Schneider übergab mir in Gold in Rollen verpackt diesen Betrag in meine Tasche. Als ich die Summe dem betreffenden Kassier einhändigte, sagte er zu mir, es fehlen 20 Fr, also hätte ich ihm nur 580 Fr. überbracht. Er übergab mir den ganzen Posten wieder zurück. Als ich das Geld und den Bescheid dem Direktor übergab, sagte er, das sei nicht möglich, ich hätte ihm ja zugesehen, wie er die Fr. 600 .--vorgezählt und verpackt habe. Ich jedoch versicherte ihm, dass ich die Geldrollen unberührt nach Bern gebracht. Er glaubte ja mir, wird sich auch mit dem Gedanken zufrieden gegeben haben, er hätte sich vielleicht auch geirrt, oder es sei der betreffende Kassier nicht ganz zuverlässig. Item, ich musste standibus noch einmal nach Bern mit dem vollen Betrag. Ein andermal übergab er mir wieder einen grossen Geldbetrag in Gold, den hatte ich auf der Post einzuzahlen, da nahm der am Schalter der Post stehende Beamte eine Schere und schnitt ein Goldstück von 20 Fr. entzwei und übergab mir die ganze Summe wieder mit dem Bescheid, dieses Goldstück sei falsch. Ich brachte das Geld wieder heim. Am gleichen Tage musste ich mit dem zerschnittenen Goldstück nach Bern zum Goldschmied Fries, in der Nähe des Bundeshauses und musste dasselbe untersuchen lassen. Fries erklärte, das Goldstück sei echt, er bezahle dafür 19 Fr.60Rp. Den Bescheid überbrachte ich der Post. Der Postdirektor erkundigte sich, da er zufällig in der Nähe war, bei dem Postangestellten und mir, was geschehen. Ich teilte ihm alles mit. Er nahm das Goldstück und prüfte es. Er fand es auch als echt. Dann übergab er es dem Postgehilfen mit dem Auftrag, es zu behalten und ein anderes Goldstück aus seiner Kasse beizubringen.
Nicht ein einziges Mal wurden wir Lehrerzöglinge mit einem Lehrer der Anstalt nach Bern geführt und uns etwa die Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt. Bern blieb uns eine unbekannte spanische Gegend. Nur an den Sonn- und Festtagen kamen wir alle vormittags zur Kirche nach Bern. Die Anstaltsbuben, weil alle reformiert waren, gingen unter der Führung ihrer Lehrer in die Heiliggeistkirche, die oben in der Stadt steht. Wir Fricktaler Lehrerzöglinge, die alle katholisch waren, trotteten allein, ohne Begleitung, die Stadt hinunter in die katholische Kirche in der Nähe des Regierungsgeländes, welche jetzt den Altkatholiken gehört. Oft besuchten aber unsere ältern Kameraden ein anderes Lokal, während dess wir jüngern den Gottesdienst mit kindlicher Frömmigkeit folgten. Auch durften wir jeweils allein in die Kirche zur Ohrenbeichte und heiligen Kommunion. Auf dem Heimwege erzählten wir einander von dem Ereignis, auch was uns so ein gwundriges Pfäfflein im Beichtstuhl ausgefragt, worüber wir uns sehr wunderten, nach Sachen fragte, die uns fremd waren.
Wir hatten also, wie gesagt, während der schönen Jahreszeit wenig Unterricht. Wir mussten das Feld bestellen, mähen, denn Mähmaschinen gab es noch nicht, dörren, einführen, das Getreide mähen, binden, heimführen, abladen, ebenso emden. Im Herbst galt es, das viele Gemüse, besonders die Kartoffeln vom Gurten herunter einzuheimsen. Die grössern und ältern Lehrerzöglinge hatten das Dreschen des Getreides zu besorgen. Einige von ihnen hatten sogar die Aufgabe, Brot zu backen für die ganze Anstalt. Also Arbeit in Hülle und Fülle, aber nur nicht dort, wozu wir eigentlich in die Bächtelen geschickt wurden, nämlich zum Studium. Darüber beschwerte sich einmal unser Vater bei Direktor Kuratli. Von dieser Zeit an hatte ich es bei diesem Herrn nicht mehr so gut.
Am Morgen waren unsere Kleider, Schuhe, Strümpfe richtig kalt. Oft lag eisiger Duft auf unsern Betten. Um 5, im Winter um 6 Uhr ertönte der Ruf des Lehrers, der bei uns schlief: Aufstehen! Da machten wir uns mühsam aus unsern Betten und begaben uns zum Brunnen vor der Anstalt, um uns zu waschen. In der Nacht erging es uns oft schlimm. Nachtgeschirr gab es keine, oft waren die Aborte geschlossen, alles finster, denn elektrische oder auch eine Petrolbeleuchtung gab es in der Anstalt nach Schlafenszeit nicht. Da musste man drei steinerne kalte Stiegen hinunter vor das Haus, wenn es nicht möglich war im obersten Gang ein Fenster nach aussen zu öffnen und dort hinunter zu „schiffen“. Es war überhaupt gar nicht die Fürsorge getroffen, uns bei Gesundheit zu erhalten, wie das jetzt in der neusten Anstalt geschieht.
Als Anstaltslehrer hatten wir Herr Schneider, der Unterricht in der Pädagogik erteilte, da wurde viel von Fellenberg und Pestalozzi doziert; Loosli gab uns Unterricht in der deutschen und französischen Sprache; Schütz, ein alter bernischer Sekundarlehrer, dozierte über Geographie, Geschichte, Naturkunde; Wenger, ein Primarlehrer von Bern erteilte jeweils Samstags Unterricht im Violinspiel und Freihandzeichnen. Vorher erteilte ein Musiklehrer Thiele aus Bern, ein Preusse, Violinunterricht.
Nun kam noch neue Arbeit für uns, Kuratli, der Vorsteher, kaufte unterhalb der Strasse, die das Bächtelengut begrenzte, noch ein Landstück voller Stauden und Unkraut, das erwarb er aber nicht etwa für die Anstalt, sondern für sich. Dieses Grundstück hatten wir Buben und Zöglinge, zu kultivieren. Kuratli liess nun auch ein Bau darauf erstellen. Es wurde daraus eine Pensionsanstalt für Herrensöhne und „Grünau“ getauft, die glaub ich jetzt noch besteht.
Wir Lehrerzöglinge waren ganz klösterlich gehalten. Nie wurde mit uns ein kleiner Ausflug auch nur in die nächste Ortschaft gemacht. Eines Sonntags im Frühjahr 1872 wurde uns Zöglingen erlaubt, einen Ausflug nach Belp und Umgebung über den Gurten, Zimmerwald, und nach der Bächtelen zu gehen. Da fiel uns ein, wir könnten unterwegs auch einmal „einkehren“. Gesagt - getan! Dies war nun der Anfang vom Ende. Als wir in die Bächtelen heim kamen, wurden schon die Psalmen herunter geleiert. Jeden Sonntagabend hatten wir nämlich Übung im Psalmensingen. Da ertönte schon von ferne der Ruf: „Ja, ja! Ihr werdet nun etwas vernehmen.“ Und richtig wurden wir vor den Kadi zitiert. Da wurde uns gedroht mit Relegation. Wir aber fürchteten uns nicht besonders. Kuratli hat uns selbst nicht getraut. Dieser hatte nämlich schon längst die üble Gewohnheit, uns jüngere Fricktalerzöglinge nach der Samstag Abendandacht zu sich in sein Privatgemach zu nehmen. Da standen wir an der Wand und mussten zusehen, wie dieser Kuratli, der ein Jungeselle war, sich bis auf die Unterhose entkleidete und sich in sein daneben stehendes Bett begab. Einer von uns musste nun zu ihm auf den Bettrand sitzen. Diese Manipulation fiel uns auf. Da erschien in einem Bernerblatt auf einmal die Bekanntmachung dieser Handlung Kuratlis von einem früheren Anstaltzögling, Wiesendanger, aus dem Toggenburg. Der Aufsatz wurde auch gelesen vom Berner Staatsanwalt. Es wurde nun Anzeige gemacht gegen Kuratli. Wir Lehrerzöglinge wurden nun einer nach dem andern in der Bächtelen von den Herren der Aufsichtskommission verhört. Bald fiel der Entscheid, aber zum schweren Umsturz des Direktors Kuratli. Eines Tages vor dem Heuet stand die Anstaltskutsche vor der Wohntüre Kuratlis. Wir standen dabei, wussten aber nicht, um was es sich handelte. Da kam Kuratli in schwarzer Kleidung mit Zilinder, nur ein kleines Handköfferchen tragend und stieg in die Kutsche. Bevor der Knecht mit ihm fortfuhr, sagte Kuratli noch zu uns: „So heuet nun, bis ich wieder zurückkehre.“ Der aber kehrte nie mehr zurück.
Zu den Anstaltslehrern gehörten auch die zwei reformierten Geistlichen Baggesen und Güder aus Bern. Diese gaben abwechselnd an 2 Halbtagen in der Woche, der ältern Abteilung der Lehrerzöglinge Unterricht in der Religions- und Kirchengeschichte. Jedesmal musste der betreffende Geistliche in der Anstaltskutsche geholt und wieder heim geführt werden. Dies hatte gewöhnlich Hohler besorgt. In unserer Abteilung sassen noch ein Kirchhofer aus Ins, ein Scheidegger aus Aarburg, ein Hinderberger aus dem Toggenburg, der klettern und tief hinunter springen konnte, ohne dass er Schaden nahm, wie eine Katze, der war unser Zeitvertreib nur aus Mutwillen, wir gaben ihm den Spassnamen Hindenburger, wahrscheinlich dachten wir damals schon an den späteren deutschen General Hindenburg; auch ein Burkhard aus Meersburg, Baden, gehörte zu uns.
Etwas Klavierunterricht erteilte uns Wenger von Bern. Eine kleine Orgel besass die Anstalt auch, die gewöhnlich gespielt wurde von einem Lehrer an den Sonntagabenden, wo die Psalmen eingeübt wurden. Noch einen Lehrer hatten wir, Hofer, ein Aargauer, der Unterricht im Schreiben und Geographie erteilte.
Im Frühjahr 1871 sahen wir auch oft uniformierte französische Soldaten auf der Strasse Bern-Belp spazieren. In der Stadt Bern waren davon viele, so war die Heiliggeistkirche total angefüllt von diesen. Es wurde aber von diesen Rothosen dazumal nicht vier Rühmliches erzählt.
Ein Ereignis blieb uns lange im Gedächtnis: An Sylvester nachts 12 Uhr wurden wir in unsern Betten geweckt, im Schlafsaal alle Fenster geöffnet, denn ab da wurde um diese Stunde die grösste Glocke im Berner Münster gezogen. Es war aber dieses nicht ein Läuten, sondern nur ein stossweises Tosen, das wir in der Bächtelen sehr gut hörten, bald nachher wurden sämtliche Glocken der ganzen Stadt geläutet, das bewirkte in uns allen ein tiefes Heimweh, weil wir in diesem Moment nicht bei unsern lieben Eltern und Geschwistern sein konnten.
Ferien hatten wir im Jahr nur einmal und zwar nach dem Heuet 14 Tage. Da fuhren wir zwei, Hürbin und ich von Bern nach Sissach, von dort gings zu Fuss nach Wegenstetten, und ich allein dann nach Hellikon, Zuzgen über den Chriesiberg heim mit meinem schweren Paket Wäsche und Kleider. Kostgeld hatten wir in der Bächtelen nicht gerade viel zu zahlen, doch an dem war’s genug, es wurde zwar uns auch in der Anstalt gewaschen, auch dann und wann wo es nötig war geflickt, ohne dass wir hiefür etwas zu zahlen hatten.
Zu Anfang des Jahres 1872 wurde nun die Lehrerbildungsanstalt in der Bächtelen aufgegeben. Die Bächtelen war von jetzt an nur noch eine Anstalt für verwahrloste Knaben reformierter Konfession und besteht jetzt noch als solche unter dem Protektorat der Schweizer Gemeinnnützigen Gesellschaft. Es wurde von der Anstaltskommission beschlossen, uns Fricktalerzöglinge Franz Keller von Hornussen, Josef Leopold Mettauer von Gipf, Ferdinand Hürbin von Wegenstetten und mich in das
Seminar Muristalden bei Bern unterzubringen, damit wir später als Lehrer der Armenanstalten wirken könnten. Wir mussten nun zuerst den Willen unserer Eltern einholen, aber alle erklärten sich für das aargauische Lehrerseminar. Nun traten wir also definitiv aus der Bächtelen und wanderten heimwärts. Nicht habe ich den lieben, beherzigenswerten Begleit- und Scheidebrief unseres wohlgewogenen Vorstehers Schneider vergessen, der mir darin, weil ich so treu und folgsam ihm gar viele Dienste geleistet, viel Glück und Segen zu meinem weitern Studium und fürs spätere Leben wünschte.
IV. Periode
Es wurde nun im Frühjahr 1872 ein neuer Kandidatenkurs am Lehrerseminar Wettingen auf den 1. Mai gleichen Jahres ausgeschrieben. Wir Bächteler meldeten uns alle vier zur Aufnahme, aber in die 2. Klasse des Seminars. Das war jedoch nicht ganz klug von uns, denn unsere Vorbildung für eine erste Klasse war doch nicht das, was die erste Klasse in Wettingen bot und zwar in allen Fächern. Unsere Anmeldung wurde angenommen, die Aufnahmeprüfung hatte stattgefunden. Wir wurden provisorisch in die zweite Klasse aufgenommen. Mit 1. Mai konnten wir eintreten.
Vorher erhielten wir von der Anstaltsdirektion ein Verzeichnis derjenige Wäschestücke, die wir mitzubringen hatten: Wieviele Hemden, Nastücher, Handtücher, Socken oder Strümpfe, Kragen, Kleidung, nebst Kamm und Bürsten. Auch musste jeder einen Vermögensausweis beilegen behufs Ermittlung des Staatsbeitrages (Stipendium) an das zu zahlende
Kostgeld. Dasselbe betrug pro Tag 1 Franken, Staatsbeitrag erhielt ich pro Quartal 20 bis 24 Franken. Sämtliche Lehrmittel hatte jeder sich selbst zu beschaffen.
Es waren nun in unserer 2. Klasse folgende Schüler: 1. Ammann Anton von Eien, 2. Braunschweig von Endingen, mit uns in diese Klasse eingetreten aus der Kantonsschule Aarau, 3. Brodbeck Emil von Therwil, Baselland. 4. May Eduard von Buckten, Baselland, 5. Friedrich Hunziker von Windisch, 6. Keller Franz von Hornussen, 7. Keller Heinrich von Mandach, 8. Keller
Julius von Endingen, 9. Dinkel Ferdinand von Eiken, 10. Hürbin Ferdinand von Wegenstetten, 11. Zehnder Konrad von Birmensdorf, 12. Rehmann Julius von Kaisten, 13. Dürst Joachim von Glarus, 14. Hächler Rudolf von Gränichen, 15. Mettauer Josef von Gipf, 16. Seiler Josef von Wohlenschwil, 17. Strebel Josef von Mägenwil, 18. meine Wenigkeit.
Später erteilte den katholischen Seminaristen ein junger Pfarrherr aus dem Luzernerbiet katholischen Religionsunterricht. Unterricht in der deutschen Sprache erteilte Hermann Brunchofer von Aarau, der ein recht hochdeutscher Verfechter war, dann mussten wir jeweils am Montag die deutsche Sprachlehre aus „Dr. Frey Sprachlehre“ herunter lesen ohne jede Erklärung, je nach 14 Tagen hatten wir ihm einen Aufsatz abzuliefern, dessen Thema er uns ohne jegliche Erklärung gegeben. Sein Nachfolger als Deutschlehrer war Daniel Mäder, bis anhin Bezirkslehrer in Muri. Er war ein guter Methodiker, es wurden unter ihm auch grössere Gedichte, Dramen behandelt. Aber punkto Sauberkeit und Genauigkeit in Kleidung und intimer Ausrüstung war er nicht sehr reinlich. Als Junggeselle ergab er sich nach und nach dem Trunke. Er sank und fiel und schliesslich liess er sich einen argen dummen Fehltritt zu schulden kommen. Wir 4. Klässler aber traten für ihn ein, die andern Klassen weigerten sich, seinen Unterricht weiter zu besuchen. Mäder musste dann gehen.
Den Unterricht in der französischen Sprache erteilte ein Pfarrer Blanc, der war reformierter Geistlicher aus dem Elsass. Er erteilte auch reformierten Unterricht den Seminaristen. Blanc zeigte ein leises vornehmes Auftreten.
Friedrich Link, ein Hochdeutscher aus Preussen, erteilte Unterricht in Gesang, Violin-, Klavier- und Orgelspiel. Das war kein beliebter Lehrer, fast immer neidischer oder übler Laune. Keinen konnte er etwa im Unterricht lachen sehen, bald flogen dem Übeltäter rohe Scheltworte an den Kopf, er jagte ihn kurzerhand vom Klavier oder der Orgel weg oder wies ihn aus dem Zimmer. Link verliess mit uns 1875 das Seminar Wettingen. Er wurde an ein deutsches Seminar gewählt.
In Geschichte, Geographie und Schreiben unterrichtete Johann Heinrich Lehner von Stilli, ein schon alter Lehrer. Er dozierte Geschichte und Geographie direkt aus seinem vor ihm offen liegenden Buche. Im Schreiben hielt er viel Taktschreiben mit uns, die Stunden, die mir sehr gefielen. In Naturkunde und Naturgeschichte unterrichtete Markus Alder, der seine Studien auf der landwirtschaftlichen Hochschule absolvierte. Er las uns auch vor, was in seinem Buche stand. Von Experimentieren war so wenig als von Botanisieren. Es war nur ein Buchstudium oder Vorlesen.
Als Lehrer der Mathematik, Geometrie, Stereometrie funktionierte Trautwetter, ein vertrockneter Zahlenmensch, der etwas langweilig war, spendete uns etwa Brocken aus dem Kurszeddel (Anm.Kurszettel) und Effektenbörsen, welches uns ein spanisches Dorf war. Nun trat noch ein weiterer Lehrer ein, der uns Unterricht erteilte in der Agrikulturchemie, Landwirtschaftslehrer Dr. A. Frey, ein junger Mann, dem wir gerne zuhörten, nur schaute er uns nie an, wenn er dozierte, seine Augen waren immer nach der Zimmerdecke oder Ecke gerichtet. Frey war auch Aufseher in der Landwirtschaft des Seminars, daneben Kassier der Anstalt, dem wir das Kostgeld zu bezahlen hatten. Dasselbe betrug 7 Fr. per Woche. Genug für solche Kost.
Primarlehrer Büchler von Brugg war unser Turnlehrer, der kam jeden Samstagnachmittag und erteilte 2 - 3 Stunden Turnen. Er selbst machte uns wenige Übungenvor, das besorgte einer von seinen Turnschülern aus Brugg, der nun in unserer Klasse war. Wir Bächteleren waren in diesem Fache eine Null, denn Turnunterricht genossen wir dort nicht, denn Feldarbeit war der Ersatz des Turnens. Auch in andern Fächern mussten wir uns sehr an den Laden legen, sonst wären wir wieder zurück gekrebst. Es fehlte aber an der nötigen Vorbildung. Unter Umständen wäre es besser für uns gewesen, wir wären in die I. Seminarklasse aufgenommen worden, wir hätten dann eine gute Grundlage in den verschiedenen Disziplinen gehabt. Für mich fehlte es gar in den Anfängen aller Fächer, denn meine Kameraden alle hatten eine Bezirksschule besucht, bevor sie in die Bächtelen eintraten, ich bloss die Bürgerschule in Säckingen. Einen Turnplatz hatten wir in Wettingen, wie ihn jetzt auch die hinterste Dorfgemeinde hat, darauf standen ein Reck und ein Klettergerüst. Von Spielen war keine Rede. Öfters schaute der Direktor Dula von seiner Wohnung aus unserm „flotten“ Turnübungen zu. Er wird auch seine eigenen Gedanken gesponnen haben über unsern Turnbetrieb.
Im Seminar wurden die Zimmer mit Holz und zwar mit Wellen geheizt. Je ein grosser Kachelofen heizte zwei daran stossende Zimmer. Jeden Samstag über die Mittagszeit hatten gewöhnlich die 3. und 4. Klässler jeder 6 Stück Reiswellen aus dem Holzhaus bei den Stallungen nahe an der Limmat hinauf zu tragen in den Holzraum im ersten Stock hinter den Seminaristenzimmern. Das Heizen besorgte der Pedell (Anm. Hilfskraft). In jeden Ofen kam eine Welle, diese waren aber verschieden gross, bald knebelreich, bald knebelarm. Daher bekam hie und da ein Ofen wenig Material zur Wärmeabgabe. da musste man oft selber nachhelfen mit dem nötigen „Haber“. Wenn die Luft in den Gängen rein war und die Holzkammer nicht so gut verschlossen, holte man hie und da etliche Knebel und warf sie in den Ofen, oder man versteckte sie in seinem Zimmer im Kasten, oder im Bett, oder zwischen dem innern und äussern Fenstern, denn man hatte immer Vorhänge und holte diese Knebel hervor, wenn es nötig war. Aber oft kam es vor, dass so ein „gfürchiger“ Wocheninspektor eine Visite machte und hinter die Vorhänge oder in den Kasten guckte, dann war das Unglück geschehen. Es war nämlich Usus, dass je ein Seminarlehrer, der im Seminar wohnte, je eine Woche Wocheninspektor war. Der hatte dann beim Morgen-, Mittag- und Abendessen im Speisesaal bei uns zu sein und Aufsicht zu halten, er durfte auch da essen. Letztern Gebrauch machte aber bloss ein Lehrer mit, das war Heinrich Lehner. Der Lehrer sass mitten in der Tafelrunde auf einem Lehrstuhl. Hinter ihm an der Wand hing in Leder gebunden ein Heft, darin standen gedruckte Titel: Morgen- und Abendgebete. Vor dem Essen hatte der neben dem Lehrer sitzende Schüler, links oder rechts von ihm, das Gebet vorzulesen, worauf man dann erst zu essen begann. Das Abendgebet lautete im Anfang: Herr! Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Diesen Satz wandte ich nun auch an, als mir die hiesigen Vereine bei Anlass meines 50jährigen Dienstjubiläums am Abend ein Ständchen brachten. Es dünkten mich diese Worte gar passend zu meinen 70 Jahren. Ich erinnere mich noch wohl dieses Momentes und wie die liebe Mutter selig weinte in der Stube, wie sie diese meine Worte hörte.
Am Morgen um 5 Uhr läutete es zum Aufstehen. Dann ging’s in den Klosterhof hinunter zum Waschen am grossen Brunnen. Jeder brachte sein Handtüchlein mit, hie und da einer auch Seife. Dann gings aber flink wieder hinauf in das warme Zimmer. Nun begann die Zimmerarbeit: Bett machen, wischen, hie und da abgestaubt. Nachher folgte das Morgenessen. Da standen auf jedem Ordinär 8 Schüsselchen, Löffel, 8 Brötchen und ein grosser Hafen mit Kaffee und Milch, schon zusammengeschüttet. Nach dem Essen wieder ein kurzes Gebet. Jetzt konnten wir noch wenige Minuten vor das Tor gehen, wer wollte. Um 8 Uhr begann der Unterricht. Nach jeder Stunde wurde ein Glockenzeichen gegeben. Es war nämlich im Seminargang eine kleine Glocke angebracht. Diese wurde von einem Seminaristen nach jeder Stunde kurz angeschlagen. Um 12 Uhr war Unterichtsschluss. Man begab sich zum Mittagessen. Dies war immer recht und genügend. Es gab Suppe und Gemüse 2 mal in der Woche mit Schweinefleisch, am Sonntag Rindfleisch, jede Fleischsorte schon in acht Stücke geschnitten, wahrscheinlich um einem allfälligen Tischstreit vorzubeugen. Einmal in der Woche gab es als Mittagsspeise Kastanien, die mochten aber viele nicht, da konnten sich besonders diejenigen tüchtig sättigen, die das Süsse liebten, zu diesen gehörte auch ich. Von 1 bis 4 Uhr Unterricht. Um 4 Uhr stand im Esssaal auf einer Bank ein grosser Korb, in welchem die „z’Obigbrötchen“ waren. Jeder nahm ein solches, damit machten wir einen Rundgang um das Kloster hinauf bis etwa zum heutigen Bahnhof Wettingen und verzehrten das trockene Brot, Flüssiges gab es nicht dazu, auch das Wirtshaus zum „Sternen“, um das wir trotteten, durften wir nicht besuchen. Nun gings wieder in das Kloster hinein. Es wurde in den Klausen gearbeitet. An einigen Tagen hatten wir „Stunde“ von 5-6 oder 7 Uhr. Dann folgte das Nachtessen, wenn man so sagen könnte. Aber es bestand nur in einer Suppe, von welcher man an einem Teller genug hatte. Oftmals konnte man sie gar nicht geniessen. Und von jetzt an sollte man so bis um 10 Uhr erst recht arbeiten.
Trotzdem wir die Suppe verachteten, wurde weder von der Lehrerschaft des Seminars, noch von der Aufsichtskommission, noch von Aarau aus etwas getan, dass wir ein geniessbares Nachtessen erhalten hätten, doch stand ja dazumal der hochverehrte Landammann Augustin Keller an der Spitze des Erziehungswesens, der behielt aber die Seminaristen und auch die Lehrer gern „drunten“. Nach dem Nachtessen hatte man seinen Hunger mit trockenem Brot zu stillen, das verschaffte man sich aus seinem Geldbeutel. In der Näher des Klosters wohnte ein Bäcker. Zu diesem wurden jedeils abends die jüngeren Seminaristen geschickt, um die hungrigen Mäuler mit Brot zu verstopfen. Eine „Schildchrott“ wurde geholt, das war ein Pfundlaibchen. Aber beim Heimgehen musste man erst noch vorsichtig sein, denn jeder Brotträger wurde angehalten, sogar gerügt, obschon dies nur zum Notwendigsten diente, zur Erhaltung der Körper- und Geisteskräfte.
Es durfte natürlich von den Seminaristen auch nicht geraucht werden, weder innert noch ausser dem Seminar. In der Nähe des Klosters war auch ein Krämer, denn es gehörten etliche Wohnhäuser, sogar auch Bauernhäuser zum „Kloster Wettingen“, so war Wirsch ein Grossbauer, der Vater des spätern Grossrat Wirsch, der aber seinen Geschlechtsnamen umgemodelt in „Wyrsch“. Bei diesem Klosterkrämer erstanden die Raucher ihren Pfeifentabak „Maryland“, das Päcklein um 25 Rp., was jetzt das Dreifache gilt. Dieser Knaster musste aber hinter verschlossenen Türen und bei verstopften Schlüssellöchern geraucht werden. Es machte nämlich mancher Wocheninspektor in der Nacht noch einmal die Runde durch die Seminargänge und sah nach, ob auch die Lichter in den Zimmern gelöscht und alles in klösterlicher Ruhe lag. Einmal wurde hinten im untern Gang der Seminaristenzimmer nach Lichterlöschen, mitten im Gang eine Reiswelle aufgestellt. Von beiden daran stossenden Zimmern wurde eine Schnur an die Welle gebunden. Wie nun der Nachtinspektor Lehner mit seiner Kerze durch den Gang schritt, wurde abwechselnd an der Schnur gezogen, da wackelte die Welle mit ihrem Kopf, auf den noch eine Mütze gestülpt worden. Lehner sah das zuerst mit Schrecken, dann schritt er keck auf das Gespenst zu und versetzte ihm mit seinem Bein einen heftigen Stoss, sodass es zu Boden fiel, dabei sagte er doch noch: Was sind auch das für Dummheiten. Natürlich brachte er das Geschehnis in der nächsten Geschichtsstunde zur Sprache.
An den Sonntagen mussten die Katholiken am Vormittag in die Klosterkirche hinunter. Wir hatten da auch zu singen. Musiklehrer Link hatte uns auch ein von ihm komponierten Kirchengesangbuch aufgeleimt. Jeden Samstag hatte ein von ihm bestimmter Zögling einige von diesen Messgesängen einzuüben und am Sonntag mit der Orgel zu begleiten. Link kümmerte sich nicht darum. Selbst unser Dula besuchte fast jeden Sonntag den Morgengottesdienst, natürlich im geheimnisvollen Versteck, wo er immer aus seinem Buche für sich las.
Beim Kloster stand eine grosse alte Scheune, die Zehntscheune des Klosters für das Zehnthaus Höngg bei Zürich, darum das Höngghaus geheissen. Dieses alte Gebäude wurde nun oft von verspäteten Klosterzöglingen zum Einlasstor ins Seminar, aber das geschah mit Lebensgefahr. Man gelangte durch das Höngghaus bloss auf das Dach des Kreuzgangs. Von diesem musste man an den Fenstern der Seminaristenzimmer anklopfen, die gegen den Hof gelegen waren, worauf ihnen sofort geöffnet und sie herein gelassen wurden. Im letzten Winter unseres Seminarkurses waren aus unserer Klasse Dürst, May, Brodbeck, bis spät in die Nacht hinein bei einem Tanzvergnügen in Staretschwil. Als Eingang benützten sie auch das Höngghaus und gelangten glücklich auf das Kreuzgangdach. Es war aber Glatteis entstanden auf dem Dach und die drei Mönche wahrscheinlich nicht mehr ganz sicher auf ihren Stelzen: Item, sie stürzten, fielen und plumsten alle drei in den Hof des Kreuzgangs hinunter. Das war für sie
eine schlimme Situation. Der Hof war nämlich abgeschlossen durch eine starke Türe mit Schloss. Den Schlüssel hiezu hatte immer der Seminardirektor. Zwei von den drei Heruntergefallenen: Brodbeck und May konnten sich an den Blitzableiterdrähten auf das Dach des Hofes schwingen, der dritte: Dürst, aber musste liegen bleiben, er hatte ein Bein gebrochen. Nun hatte man zuerst den Schlüssel beim Direktor zu holen, den Verunfallten herauf zu schaffen und den Anstaltsarzt Keller in Baden zu holen. Das gab schlimme Tage für die drei Nachtwandler. Am schlimmsten ging es Dürst, er konnte bis Frühjahr nicht aufstehen und die Patentprüfung nicht machen mit seinen Kameraden.
Im Erdgeschoss des Seminars gegenüber dem Eingang, befindet sich nämlich der sogenannte Kreuzgang, ein in Viereck gelegener Bau, ähnlich den Laubengängen in Bern. Die Fenster sind alle nach dem lichten Hof gerichtet, ein unüberbauter Platz. Die Fenster haben alle Glasmalereien, es sind farbige Bilder aus dem alten und neuen Testament. Es sind alles Bilder in roter, grüner, blauer Farbe. Dieser Kreuzgang wird sehr häufig besucht von Fremden, besonders von solchen im Sommer von Baden her zur Zeit der Bädersaison. Der Pedell des Seminars ist der Führer, er gibt auch Erklärung über die Bilder, wahrscheinlich sind darüber auch Schriften erhältlich. Auch die Klosterkirche ist interessant, besonders im hohen Masse die Chorstühle, welche schöne Schnitzerabreiten aufweisen.
Die das Kloster umgebenden kleinen Häuschen und das kleine Ökonomiegebäude des Klosters sind jetzt umgebaut und dienen zu Unterrichtszwecken. Südlich vom Seminar ist der Garten und gegen die Limmat hin war seinerzeit ein Rebberg angelegt. Dieser verlockte uns besonders zur Herbstzeit zu kleinen Spaziergängen. Bei einem solchen passierte es mir mit andern, dass wir von den süssen Trauben stibitzten. Wir wurden ertappt und angezeigt. Unter der 3. Quartalsrechnung figurierte noch ein Zusatz: Wegen Traubendiebstahl 2 Franken. Das war doch zu arg, denn ein Dieb war ich in meinem Leben nie. Diese Bemerkung in der Quartalsrechnung werden wohl meiner Kameraden auch sehr empfunden haben. Den Obolus von 2 Fr. hätte die Seminarkasse auch in anderer Form erhalten, ohne uns bei den Eltern so hinzustellen.
Unser Spaziergang am Sonntag war fast allgemein nach Baden. Dort versammelten wir uns am Abend vor dem Heimgang in der „Faubourg“ und
marschierten dann mit einem schönen, gewöhnlich neu eingeübten Marschlied durch die Stadt über die alte hölzerne Limmatbrücke, denn eine andere Brücke hatte Baden damals noch nicht, heimwärts.
Während unserer Seminarzeit gab es für keine einzige Klasse nur irgend einen Reiseausflug, wie ihn jetzt jede Klasse einmal im Jahr hat. Einmal durften wir abends nach Baden in die Theateraufführung, die von der dortigen Schauspielergruppe gegeben wurde, die Deborah. Dies war aber auch das einzige Mal in den 3 Jahren, dass wir nachts oder zu einer Aufführung nach Baden oder sonst wohin gehen durften. Wir wohnten eben in einem Kloster. Der Klostergeist wurde vom damaligen Erziehungsdirektor Augustin Keller so richtig gehandhabt. Er wollte die zukünftigen sowohl als die amtierenden Schulmeister immer noch „drunten“ behalten.
Es wurden zu meiner Zeit auch noch Zöglinge bei Feldarbeiten, so bei Heuet und Erntezeit dort beschäftigt. Eines Tages vor den Sommerferien wurde uns vom Ökonomieverwalter bekannt gegeben, dass diejenige Zöglinge, die in der Erntezeit im Seminar helfen wollen, sich melden möchten. Ich meldete mich auch. Während den Ferien waren wir unser ca. 20 dort, wir erhielten pro Tag glaube ich 2 Fr. nebst Kost und Wohnung. So konnte ich dem Vater 12 Fr. heimbringen für eine Woche.
Es wurde während der Seminarzeit das Kloster oder jetzt die Irrenanstalt Königsfelden neu erbaut. Als dieser Bau nun fix und fertig eingerichtet war, arrangierte das ganze Seminar, Lehrer und Schüler einen Ausflug in die nun neu errichtete Irrenanstalt Königsfelden. Man staune! Die Aufenthaltsräume waren noch nicht bezogen zum Glück. Am Abend vor der Rückreise hatten sich die Zöglingen unter Aufsicht und Leitung des Seminarlehrers Markwalder im Gasthaus Füchsli versammelt. Aber die Seminaristen gingen bald da, bald dort hinaus, sie wollten auch einmal allein ihre Wege gehen. Als dann immer weniger wurden, sagte auf einmal Markwalder: „Ja, ja, die Seminaristen fangen an zu „schwienen“, das heisst, sie werden an Zahl weniger (schwien = Mundart). Markwalder warf aber gar oft, auch im Unterricht Mundart und Schriftsprache durcheinander. Er bediente sich bei den Lektionen fast immer des Lehrbuches von Brehm. Als einmal einer unruhig war, rief er ihm zu: Ich werfe den Brehm!
Von der 4. Klasse an mussten wir anfänglich alle zusammen je 1 bis 2 Stunden in die Übungsschule, damals Musterschule geheissen, zuerst nur als Zuhörer. Diese Schule wurde von Gottlieb Gloor geführt, dem Vater des späteren Bezirkslehrer Gloor in Rheinfelden und Vorsteher der Anstalt Aarburg. Gottlieb Gloor erteilte dert 1. Seminarklasse auch Gesangsunterricht. Wir besuchten die Übungsstunden unter Gloor recht gern. Im 3. und 4. Quartal des letzten Jahres hatten wir nun jeder je ½ - 1 Stunde Unterricht den Schülern der Übungsschule in den verschiedenen Disziplinen zu erteilen. Nach jedem Halbtag hatte dann Gloor eine Beprechung darüber, was ein jeder in seiner Unterrichtsstunde bezüglich der Behandlung gefehlt oder wie überhaupt dieses oder jenes Fach zu behandeln sei. Aber leider entgleiste Gloor später in gefährlicher Weise und brachte dann einige Zeit dort zu, wo sein Sohn dann auch versorgt wurde.
Wir IV. Klässler machten auch einen Schulbesuch mit Gloor in Ehrendingen einen vollen halben Tag.
Endlich nahte der Schluss der Seminarzeit. Am 13. und 14 . April 1875 waren die Patentprüfungen, schriftlich und mündlich unter Aufsicht und Fragestellung der Inspektoren des Seminars. Am 15. überreichte sodann der Erziehungsdirektor Keller einem jeden sein Patent, seinem Laufpass ins öffentliche Leben, zur Arbeit. Nun musste ein jeder zusehen, wohin ihn das Schicksal schlug. Jetzt galt es erst, das zu verwerten und anzuwenden, was er nach so vielen Jahren mit Mühe und Geduld, Arbeit, sich errungen. Der eine war schnell versorgt, der andere später. Die zwei Baselbieter Brodbeck und Mai bildeten sich weiter aus in den mathematischen und naturkundigen Fächer an der Universität Zürich.
Noch ein Erlebnis taucht in mir auf aus der Seminarzeit. Es war vor den Herbstferien. Da wurde uns am Abend bekannt gegeben, dass mit heutigem Tage die Ferien beginnen. Wir packten unser Tröglein schnell. Vom Seminar aus fuhr der Pedell auf einem Wagen unsere Siebensachen nach dem Bahnhof Baden, eine Station Wettingen gab es dazumal noch nicht, weil überhaupt die Bahnlinie auf dem linken Limmatufer von Baden bis Killwangen lag, somit gab es auch noch keine Bahnbrücke über die Limmat.
An selbigem Samstagabend war wie gewohnt Abendandacht im Musiksaal. Dies war immer so vom Direktor Dula eine Wochenrevüe mit Anstandsregeln in allen Fällen. Dann las er uns aus einem Andachtsbuch ein kurzes tief religiöses Gebet vor, wir Seminaristen sangen zwei passende Lieder unter Leitung eines Zöglings. Es war dies immer eine bildende Erbauungsstunde für alle. Wir hätten diese Abendandacht nicht gerne fallen lassen. An jenem Abend fassten wir Fricktaler: Keller von Hornussen, Joh. Mettauer von Gipf, Ferd. Hürbin von Wegenstetten, Dinkel von Eiken und die 2 Baselbieter den Entschluss, gleichen Abends noch heimzureisen. Das ging nun flink. Um 9 Uhr abends fuhr der letzte Zug von Baden nach Brugg ab. Wir erwischten den Zug noch. In Brugg gab es noch ein kleines z’Nüni und nun gings auf Schusters Rappen über den Bötzberg, denn durch denselben konnten wir noch nicht. Auf dem Bötzberg nach der Wirtschaft eigneten wir uns einen Buckel an ab einem Bohnenfeld. Nun blieb einer um den andern nach und nach in seinem erreichten Heim zurück. Von Eiken, wo ich Dinkel noch verlor, hatte ich noch allein zu wandern und kam etwa 4 Uhr morgens müde, mit wunden Füssen nach Mumpf.
Übersetzung der Kurrentschrift
und Auswahl der Illustrationen:
Gerhard Trottmann
Anhang: Kurrentschrift aus „Wikipedia“